|
|
|
Cheopspyramide
RE: Cheopspyramide
in Pyramiden - Cheopspyramide 30.08.2017 09:21von Simbelmyne • 32.666 Beiträge
Geheimes Wissen: Liegt in den Pyramiden die Quelle und Urkraft des Universums und dienten sie als riesige Energiekraftwerke?
https://dieunbestechlichen.com/2017/08/g...rgiekraftwerke/

RE: Cheopspyramide
in Pyramiden - Cheopspyramide 27.10.2017 11:10von Simbelmyne • 32.666 Beiträge
Die Pyramiden und das Pentagon
https://dieunbestechlichen.com/2017/10/d...pentagon-video/

RE: Cheopspyramide
in Pyramiden - Cheopspyramide 02.11.2017 22:40von Simbelmyne • 32.666 Beiträge
Forscher entdecken riesigen Hohlraum in der Cheops-Pyramide
http://www.zeit.de/wissen/2017-11/aegypt...-pyramide-gizeh
https://www.google.de/search?source=hp&e.....0.Z_jAJwyWYcg

RE: Cheopspyramide
in Pyramiden - Cheopspyramide 03.11.2017 10:03von Simbelmyne • 32.666 Beiträge
“Großer Hohlraum” im Innern der Cheopspyramide entdeckt
https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de...ramide20171102/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ZB-MOGw0RMo

Korff - Friedrich Wilhelm Korff - Musik in der Cheopspyramide
in Pyramiden - Cheopspyramide 18.03.2018 14:16von Simbelmyne • 32.666 Beiträge
Cheopspyramide gebaut, erschaffen und ausgerichtet durch musikalische Proportionen
Friedrich Wilhelm Korff
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_Korff
https://www.google.de/search?source=hp&e...1.0.bhKM1ZLgXz4
https://www.google.de/search?ei=zWWuWrDw...1.0.34hpBTx3EzY
https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/prop..._SAeK_18.07.pdf
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?_...g+der+pyramiden
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?_...schen+Pyramiden
Nanu, sie kennen Korff noch nicht ?
Viele Philosophen sind Meister darin, sich auf höchstem intellektuellem Niveau zu vergegenwärtigen, dass sie nichts wissen. Anders Friedrich Wilhelm Korff. Als erstem Vertreter der Neuzeit scheint es dem Geisteswissenschaftler gelungen zu sein, eindeutig nachweisbare mathematische Gesetzmäßigkeiten in Ägyptens architektonischem Erbe zu entschlüsseln und damit das Bauprinzip der Pyramiden offenzulegen.
»Nicht schon wieder!«, mögen Insider entnervt aufstöhnen. Schließlich werden alle paar Jahre neue »Erklärungen« aus dem Hut gezaubert, wie die imposanten Bauwerke einst errichtet worden sein sollen. Jede von ihnen weist Schwachstellen auf - und jede widerspricht der anderen. Ist Korff also nur ein weiterer Wirrkopf, dessen Theorien bald niemanden mehr interessieren? Einiges spricht dagegen: Der Mann hat sich erstens sowohl als Philosophie Professor an der Leibniz Universität Hannover als auch als Technikgenie und Literaturpreisträger in Forscherkreisen durchaus einen Namen gemacht.
Und zweitens — ein Novum in der Geschichte — halten gleich mehrere renommierte deutsche Ägyptologie-Kapazitäten den Daumen hoch, was seine kontroverse Theorie betrifft. Obwohl sie manchem nicht in den Kram passen dürfte. Gemäß Korff bauten die Ägypter die Pyramiden nämlich exakt »nach den Proportionen musikalischer Intervalle«. Die Bauwerke, so der findige Professor, können damit als »Stein gewordene Musik« bezeichnet werden.
Seine spektakulär klingenden Erkenntnisse präsentierte der hannoversche Forscher 2008/2009 unter anderem im Museum August Kestner in Hannover, im Pelizaeus-Museum in Hildesheim und im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg. Dort erläuterte er, wie ihm der Nachweis gelang, dass die Neigungswinkel aller Pyramiden aus musikalischen Intervallen antiker Tonarten gebildet sind. Vier Jahre brauchte der Forscher, um »das Konstruktionsprinzip der Pyramiden« zu enträtseln.
Seine Forschungsergebnisse hat KorfF in einem ebenso teuren wie dicken Wälzer dokumentiert. Ein Monumentalwerk, das vor komplizierten Aussagen nur so strotzt: So wird darin etwa gezeigt, dass die Cheops-Pyramide einen Neigungswinkel aufweist, »der dem Intervall einer großen Terz in der antiken Tonart Diatonon malakon entspricht«, wie ein findiger taz--Journalist schreibt, der sich als einer der wenigen durch Korffs Zahlenorgien ackern mochte. »Oder dass die Pyramide Niuserres einen Neigungs¬winkel hat, der einer großen Terz in der Tonart Dia¬tonon ditonaion entspricht.«
Weiter betont der Professor, dass die ägyptische Elle als Längenmaß zu korrigieren sei: Nicht 0,525 Meter messe sie, sondern 0,52236 Meter. Die Cheops-Pyramide sei somit nicht 440 Ellen lang, wie angenommen, sondern 441 Ellen. »Ferner entspricht das Volumen eines Pyramidions einem doppelten musikalischen Tritonus.« Nicht zuletzt glaubt KorfF auch das Geheimnis der Zahl 5040 geknackt zu haben, »die Piaton zur Basis seines Idealstaates erklärt hat. In Wirklichkeit ist das eine Pyramidenzahl. Sie enthält den kompletten Satz der Abmessungen der Cheops-Pyramide in überprüfbaren Ellenlängen.«
Für Laien kaum nachvollziehbare Aussagen. Wer von der Vergangenheit träumt, mag den Taschenrechner nicht zücken. Umso stärker aufhorchen lässt deshalb die positive Reaktion renommierter deutscher Agyptologen. Statt wie üblich wie die Rohrspatzen über »Amateurtheorien« zu schimpfen, flöten sie diesmal lieblich wie Nachtigallen. »Herrn Korffs Berechnungen und seine These erscheinen mir zwingend«, jubelt etwa Professor Rainer Stadelmann, früherer Leiter des Deutschen Archäologischen Instituts in Kairo. »Dieses Be¬rechnungssystem ist eine ganz großartige (Wieder-)Entdeckung der antiken Berechnungen aufgrund altägyptischer Rechenmethoden und der bei Piaton überlieferten Harmonielehre.«
»Hier wird ein Augiasstall ausgemistet«, posaunt auch Professor Hans Poser von der Technischen Universität Berlin in alle Welt. »Alle Pyramidenproportionen fügen sich den uns seit Pythagoras und Piaton geläufigen Proportionen von der Oktav an (entsprechend der Obertonreihe) und den damit verknüpften Zahlenverhältnissen bis hin zu den Pyramidenzahlen. Ausgehend von solchen idealen Proportionen erzwingt dies eine umwälzende Einsicht: Die Pyramidenbauer waren nicht nur Meister der Planungs-, Mess- und Bautechnik, sondern sie müssen Jahrhunderte vor den Griechen über ein tiefes Wissen in Geometrie, Zahlentheorie und Harmonielehre verfügt haben!«
Selbst Professor Jan Assmann von der Universität Heidelberg setzt KorfF ein Denkmal: »Ihre Ergebnisse sind schlagend und werfen ein völlig neues Licht auf den Pyramidenbau wie auf die Baukunst überhaupt. Freilich: So recht Sie ohne Zweifel haben, so schwer werden wir Agyptologen es haben, Ihre Entdeckungen mit dem in Beziehung zu setzen, was wir sonst von Ägypten, den Pyramiden, der ägyptischen Musik und Mathematik wissen.«
Doch es gibt auch Gegenstimmen — zumindest eine. So glaubt der seit 2008 promovierte deutsche Ägyptologe Frank Müller-Römer den Professor widerlegen zu können, wie er im Fachblatt Kctvict auf sechs Seiten zu erläutern ver¬suchte. Für ihn »drängt sich der Verdacht auf«, dass die von Korff »an den Abmessungen der Pyramiden vorgenommenen Korrekturen« nur erfolgten, um sie mit seiner Musiktheorie in Einklang zu bringen. Gewisse archäologische Befunde seien gar komplett ignoriert worden. Weil sie Korffs Überlegungen widersprechen?

RE: Cheopspyramide
in Pyramiden - Cheopspyramide 24.03.2018 09:06von Simbelmyne • 32.666 Beiträge
Die Technologie und Zeitkapsel der großen Pyramide
https://dieunbestechlichen.com/2018/03/d...ossen-pyramide/

RE: Cheopspyramide
in Pyramiden - Cheopspyramide 08.07.2018 18:18von Simbelmyne • 32.666 Beiträge

RE: Cheopspyramide
in Pyramiden - Cheopspyramide 31.07.2018 20:26von Simbelmyne • 32.666 Beiträge
Forscher machen sensationelle Physik-Entdeckung in Cheops-Pyramide
https://de.sputniknews.com/panorama/2018...die-entdeckung/

RE: Cheopspyramide
in Pyramiden - Cheopspyramide 30.08.2018 08:33von Simbelmyne • 32.666 Beiträge
In Ägypten wurden Artefakte gefunden, die niemand erklären kann!
https://dieunbestechlichen.com/2018/08/i...erklaeren-kann/

Cheops gebaut per Rampe ? Rampentheorie ?
in Pyramiden - Cheopspyramide 01.09.2018 12:14von Simbelmyne • 32.666 Beiträge
Cheopspyramide gebaut per Rampe ? Rampentheorie ? eher nicht !
Einer der Hauptgründe warum der Cheopsbau per Rampe nicht funktioniert ist das Steinquader nicht um Ecken gezogen werden können -
denn, um dies zu bewerkstelligen mußte die "Zugmannschaft" ja erstmal an der Ecke vorbei sein und gerade aus laufen und den Steinquader soweit ziehen das er nun gewendet und in eine andere Richtung gezogen werden konnte, für diese "Zugmannschaft" und deren Manöver ist aber auf der Rampe kein Platz und kein Weg vorhanden, es geht nur in die Luft gerade aus oder per Fall direkt zur Erde hinunter !!!
hätten sie das "abbiegen" dennoch versucht wäre der zu transportierende Steinquader auf die bereits vorhandene Ecke geknallt und festgesessen. Das bei solch einem Manöver der Steinquader beschädigt werden könnte ist ein Risiko das die damilge Bauleitung bestimmt nicht eingegangen ist ! wäre da nur eine klitze kleine Macke bzw. ein Stückchen vom Quader abgebrochen oder einen Riss bekommen wäre der Quader unbrauchbar ! einzig die Umkehr wo sie hergekommen sind wäre noch möglich gewesen, so aber baut man keine Pyramiden !
Schieben klappt auch nicht weil die Fläche des Steinquaders zu klein ist um hunderte Männerhände oder Stangen darauf zu anzulegen ganz zu schweigen davon das die Männer nebeneinander gehen bzw. sich bewegen mußten , doch dafür ist am Steinquader kein Platz !
schwere Steinblöcke , transportiert auf "Kuven" (Schlitten) ist absolut möglich ! das der Transport so leicht wie möglich sttfinden konnte dürfte die Bodenfläche nicht nur sehr glatt und eben sondern auch sehr glitschig vorbereitet gewesen sein.
Fazit : selbst wenn genügend Leute Hand an den Steinquader gelegt hätten, sie wären ausgerutscht da kein Stand und keine stabile Stütze auf dem Boden vorhanden war um ihre Füße zu fixieren.....................
aber seht und lest selbst




In langjähriger Forschung untersuchte Oscar M. Riedl die unterschiedlichen Theorien, Berechnungen und Modelle zum Pyramidenbau. Seine Erkenntnisse sind klar, überzeugend und nachvollziehbar dargelegt. Mit dem Haupttitel seines Buches Die Maschinen des Herodot gibt er im Grunde seine Marschroute vor, die er konsequent, erkenntnisoffen und durch viele Recherchen untermau¬ert darlegt. Wir sollten hier zunächst noch einmal auszugsweise Herodot zitieren, um uns mit seinen Angaben vertraut zu machen, die Riedls Studien zugrunde liegen:
»Einige waren beauftragt, den Transport der Steine aus den Stein¬brüchen bis zum Nil durchzuführen [...], andere den Transport den Strom entlang mit großen Flößen [...]. Es arbeiteten dann im Schicht¬wechsel von je drei Monaten ununterbrochen 100 000 Mann [...]. Zehn Jahre wurden gebraucht, um die Straße zu bauen, auf der die Steinblöcke herangeschleift wurden, eine gewiss nicht kleinere Leis¬tung als der Pyramidenbau. Sie wurde in Steinquadern gebaut [...] und Kammern in den Felsen gehauen, die der Pyramide als Basis dienen [...]. Zwanzig Jahre wurden gebraucht, um die Große Pyrami¬de zu errichten [...]. Sie wurde mit gehauenen, geglätteten und vollendet gefügten Steinblöcken abgedeckt.
Die Pyramide wurde folgendermaßen hergestellt: zuerst wie ein Stufenbau mit einer Reihe von Absätzen [...]. Wenn die Absätze hergestellt waren, wurden die verbleibenden Steine durch Maschinen aus kleinen Balken hochgehoben.
Die Maschinen beförderten die Steine vom Boden zur ersten Stufe. Dort wurden sie auf eine andere, schon bereitgestellte Maschine umgeladen und auf die zweite Stufe gehoben und von dieser auf die dritte und so fort, denn die Zahl der Stufen entsprach jeweils die der Maschinen [...].
Zuerst wurden die höchsten Stellen der Pyramide geglättet, dann die folgenden und zuletzt die untersten und die der Basis [...].«
Viele der bautechnischen Probleme werden von Riedl ganz pragmatisch durch einfache Berechnungen auf den Prüfstand gestellt. Sie zeigen beeindruckend auf, wie schnell man sich bei der Beurteilung der betreffenden bauphysikalischen und technischen Probleme irren kann. Betrachten wir zuerst das viel diskutierte Thema der Rampen:
»Unverständlicherweise aber nimmt man bei der Problemlösung immer noch Rampen zum Transport der Steine an [...]. Es wurde errechnet, dass täglich 300 bis 320 Steine angeliefert werden mussten, sollten 20 Jahre zum Bau ausreichen. Bei der Annahme eines Zwölf-Stunden-Tages hätten die Treidelzugkolonnen in Abständen von circa 135 Sekunden einander folgen müssen, in etwa 20 bis 25 Metern [...].«
Was die Durchschnittsblöcke mit einem Gewicht von 2,5 Tonnen betrifft, kann sich Riedl einen Transport auf Rampen noch irgendwie vorstellen. Dagegen erscheint es für ihn ausgeschlossen, die Granitsteine für die Entlastungskammern mit ihrem Gewicht von 40 bis 60 Tonnen über irgendeine Art von Rampe auf den Pyramiden¬stumpf in mindestens 68 Meter Höhe zu schleppen.
An anderer Stelle geht er dann auf die unterschiedlichen Arten möglicher Rampen sowie auf deren postulierte Nutzung ein. Bravourös widerlegt er Modelle, wie zum Beispiel Zugkraftberechnungen von Gorges Goyons zu dessen vermuteten Spiralrampen, und weist viele Ungereimtheiten und Fehler in diversen Modellrechnungen nach. So nimmt G. Goyon (1979) für den Transport eines 2,5 Ton¬nen schweren Steines mit Schlitten und Seilen ein Gesamtgewicht von circa drei Tonnen an. Bei einer mäßig angenommenen Zug¬leistung von zwölf Kilogramm pro Mann, die für eine Langzeit¬belastung in praller Sonne durchaus vertretbar erscheint, und bei einer geringen Steigung von 5,6 Zentimetern pro Meter sowie einem Reibungskoeffizienten von 0,25 berechnet Goyon die Größe einer Treidelmannschaft mit 78 Mann ohne Begleiter. Dies jedoch ergibt bei gleichen Voraussetzungen für den Schlepp eines 41 Tonnen schwe¬ren Granitblocks hochgerechnet sage und schreibe 1066 Mann! Bei diesen 41 Tonnen würde es aber nicht bleiben, denn die Schlitten und Seile würden mindestens weitere vier Tonnen auf die Waage bringen, was noch zu gering angesetzt ist. Auf Grundlage der Berechnungen von Goyon wären nun pro Schleppzug mindestens 1170 Treidler nötig. Unter der Annahme, dass die mäßig gut verpflegten Arbeiter ein durchschnittliches Körpergewicht von je 60 Kilogramm auf die Waage brachten, macht das nochmals 70 Tonnen aus. Alles zusammen ergibt dies: 45 Tonnen für Schlitten und Stein sowie 70 Tonnen für die Zugmannschaft =115 Tonnen.
Riedl bringt die Konsequenzen auf den Punkt: »Damit wäre die Sache praktisch auch schon am Ende! [...] Kein Bauleiter würde es wagen, diese Massen auf einer Rampe zu bewegen, die nicht wenigstens so massiv angelegt ist, dass sie auch das doppelte Gewicht tragen konnte, und zwar an jedem beliebigen Punkt, ohne Schwachstellen.« Goyons Wendelrampen-Theorie, die von vielen Ägyptologen immer noch favorisiert wird, widerlegt er kurz und bündig: »Die Ecken der Rundrampen so weit auszubauen, dass der Treidelzug mit 1170 Mann herumkäme, ist ausgeschlossen
Die Beförderung mittels Wendel- oder Spiralrampen stößt spätestens beim Transport der größeren Bauteile aus Granit an ihre physikalischen Grenzen. Schwere Blöcke mit einem Gewicht über 40 Tonnen konnten von den Treidelmann¬schaften niemab um die Ecken herumgeschafft werden. Zudem hätten solche Rampen aus Ziegelstein oder aus Lehmziegeln niemals den auftretenden mecha¬nischen Belastungen standgehalten. Die logistischen Schwierigkeiten bei der Rampennutzung sind mehr ab offensichtlich.
Einen 45t Schlitten nun von hinten um die Ecke zu schieben ist ebenfalls aussichtslos [viele Balken haben mehr als 50 Tonnen Gewicht]. Auch wenn man den möglichen Kraftaufwand für kurze Zeit vervielfacht, wäre einfach nicht genug Angriffsfläche vorhanden, um genügend Arbeiter anzu¬setzen.«
Um das Rampenthema abzuschließen, sei Folgendes noch hinzuge¬fügt: Mit Sicherheit wurden provisorische Rampen zum Herbeischaf¬fen des Baumaterials errichtet. So verwies Haas (2010) auf die Über¬reste einer Transportrampe, die vermutlich beim Bau der Pyramide Verwendung fand. Außerdem wurden niedrige Baurampen mit be¬scheidenen Höhen von zehn bis 15, vielleicht sogar bis 20 Metern mit großer Wahrscheinlichkeit angelegt, wie evidente Reste nahe der Cheops-Pyramide belegen. Die Vorstellung hoch emporragen¬der Direktrampen hingegen, aber auch jene der sich um das Bauwerk windenden Spiral- oder Wendelrampen, gehören definitiv aus den wissenschaftlichen Fachpublikationen gelöscht. Sie funktionieren aus bauphysikalischer Sicht einfach nicht, was den gesamten Steintransport in große Höhen betrifft. Es ließen sich noch viele weitere Gründe für die Unmöglichkeit großer Baurampen anführen. Belassen wir es hier dabei, abschließend Riedls Verweis auf den »Vater der Geschichts¬schreibung« zu zitieren: »Herodot hätte von Rampen berichtet, wenn es solche gegeben hätte. Aber Herodot sagt: Hebemaschinen!«
Weiter im Text :
Der Gedanke der schnecken¬förmig umlaufenden Transportrampe wird nun seit Cotsworth öfters abgewandelt. Die schiefe Ebene aus Luftziegeln, parallel zu den Wän¬den einer vorerst stufenförmigen Pyramide angelegt, schlägt wieder U. Hölscher vor. (Das Grabmal des Königs Chephren, Leibzig 1912)
Die starken Steigungen, die dabei angenommen werden, machen viel¬leicht die Anlage einer Treppe notwendig und ermöglichen es besten¬falls, leichtere Lasten auf Tragen zu befördern, z. B. bei der Pyramide von Sakkara oder bei späteren Ziegelpyramiden. Von technischen Ap¬paraturen im AR ist er überzeugt.
Ein interessantes Modell einer Pyramide mit umlaufenden Transport¬rampen steht im Museum of Science in Boston/Massachusetts. Von je¬der Ecke der Pyramide steigt eine Rampe hoch, sodaß vier Bahnen über¬einander liegen, auf welchen die Transporte und die rückkehrenden Mannschaften einander nicht begegnen. Die Breite der Bahnen wird aber so schmal, daß, wie bei allen Rundumrampen, der Wendeplatz an den Ecken bereits unten, aber noch mehr oben bei verkürzten Seiten¬längen jeden Materialzug unmöglich machen muß.
Georges Goyon (Die Cheopspyramide, Bergisch Gladbach 1979) nimmt wieder eine Spiralrampe an, sie ist keine Doppelschraube wie bei Cotsworth, dadurch auch weniger steil. Cotsworths Rampe rastet auf offenen Stufen auf, in welche die Verkleidung erst beim Abbau der Rampe eingebaut werden soll. Dies würde aber offenbar eine völlig gleichmäßige Stufenanlage voraussetzen, die ja sichtlich nicht vorliegt. In die durch das Herausbrechen der Verkleidungssteine sich heute zei¬genden Leerstellen damals die Verkleidung einzeln einzupassen, wäre so schwierig gewesen, daß man es als unmöglich bezeichnen kann. Also läßt Goyon seine 14 m breite und 2600 m lange Rundumrampe auf die Verkleidung aufbauen, wobei aber die Verkleidungssteine nicht fertig geglättet sein dürfen, sondern Possen, also Buckel haben müssen, um den Sitz der Rampenmauer zu gewährleisten. Mit einer ungeheueren Ziegelmasse wird also die Pyram. umbaut und entzieht sich während der gesamten Bauzeit jeder Kontrolle von außen, kann auch nicht anvisiert werden. Erst nach Fertigstellung des Baues soll diese Umhüllung abge¬tragen und die Wände behauen und poliert werden.
Georges Goyon bringt Zugkraftberechnungen, die in vieler Hinsicht aufschlußreich sind. In der Widerlegung anderer Berechnungen nimmt er für den Transport eines 2,5 t-Steines mit Schlitten, Seilen usw. ein Gesamtgewicht von 3 t an. Bei der mäßig angenommenen Zugleistung von 12 kg pro Mann, was aber für eine Langzeitbelastung in praller Sonne durchaus vertretbar erscheint, und bei ebenfalls mäßiger Stei¬gung von 5,6 cm/m sowie einem Reibungskoeffizienten von 0,25 kommt er auf eine Treidelmannschaft von 78 Mann, ohne Begleiter. Das ergibt aber bei gleichen Voraussetzungen für den Zug von 41 t gleich 1066 Mann. Bei diesen 41 t würde es aber nicht bleiben. Wenn man für 2,5 t eine Zusatzlast von 500 kg annimmt, würde man für 41 t einen sehr schweren Schlitten und viele Seile, also leicht 4 t annehmen müssen, ein Gesamtgewicht von 45 t, also 1170 Treidler. Damit wäre die Sache praktisch auch schon zu Ende! Aber rechnen wir weiter: 1170 Treidler, von denen wir annehmen, daß die ausgemergelten, mäßig ver¬pflegten Leute nur ein Untergewicht von 60 kg auf die Waage bringen, machen wieder 70 t, also dazu der Stein von 45 t = 115 Tonnen.
Die Züge folgen einander in Abständen von 20—25 Metern, es sind also stets mehrere Züge auf einer Rampe unterwegs. Dazu kommen die Arbeiter, die in der Gegenrichtung mit ihren leeren Schlitten absteigen. Kein Bauleiter würde es wagen, diese Massen auf einer Rampe zu bewe¬gen, die nicht wenigstens so massiv angelegt ist, daß sie verläßlich das doppelte Gewicht tragen könnte, und zwar an jedem beliebigen Punkt, ohne Schwachstellen. Noch immer könnten sich die 1170 Mann auf der Geraden bewegen; die Ecken der Rundumrampe soweit auszubauen, daß dieser Treidelzug herumkäme, ist ausgeschlossen. Den 45 t-Schlit-ten nun von hinten um die Ecken zu schieben, ist ebenfalls aussichtslos. Auch wenn man den möglichen Kraftaufwand für kurze Zeit verviel¬facht, wäre ja nicht genug Angriffsfläche vorhanden, um genügend Ar¬beiter anzusetzen.
Goyon kommt mit dieser Berechnung nicht zurecht. Hier hat es sich nur um die Widerlegung eines Vorgängers gehandelt, aber er braucht die gleichen Berechnungen ja später für die von ihm als Lösung des Trans¬portproblems selber vorgeschlagene Rundumziegelrampe.
Er behilft sich jedoch ganz einfach, wenn ich zitieren darf: „Die An¬zahl der Männer beträgt dann also 1066 [in Wahrheit 1170], verteilt auf drei Kolonnen, sind es pro Kolonne 356 [390!] Mann. Treidelkolonnen von dieser Größe sind aber indiskutabel wegen der gegenseitigen Behin¬derung und des erdrückenden Gewichtes, das auf dem Gerüst lastet. Wir würden es daher vorziehen, einen kleineren Reibungskoeffizienten an¬zunehmen oder im Vertrauen auf den Erfindungsreichtum der alten Ägypter bei dem Manöver völlig [die Reibung] wegzulassen, wie Chev-rier es vorschlug. Man hätte also zu berücksichtigen das reine Gewicht des Schlittens und sonstigen Transportmaterials von rd. 11. Die Formel sieht dann folgendermaßen aus: K = 42.000 X sin alpha; K = 42.000x0.061 = 2562 kg. Bei einer Zugkraft von je 12 kg würden rd. 214 Mann benötigt, aufgeteilt in drei Kolonnen, zu denen Ersatzleute,
.
Mannschaftsführer, Wassergießer kämen, d. h. ungefähr 250 Mann, eine Zahl, die durchaus denkbar ist. In Hinblick auf den Transport eines durchschnittlichen Blocks von 3000 kg, K = 3000x0,061 = 183 kg, d. h. 16 Mann oder 25, wenn man die Begleiter einbezieht."
Aber noch immer nicht, auch mit dieser „reibungslosen" Zauberei nicht, kommt man bildlich und praktisch um die Ecken herum.
Für den Schlitten, der 2,5 t tragen soll, und sonstiges Zubehör 500 kg anzunehmen, für die Trag- und Zugausstattung von 41 t jedoch nur das doppelte, ist zu wenig, weil man das wahre Gewicht nicht wahr-haben will. Sich beim Transport durch Schlitten, dessen Kufen ja sicher nicht zu schmal sein dürfen, ganz einfach aller Reibungsanteile „im Vertrauen auf den Erfindungsreichtum der alten Ägypter" zu begeben, ist ein Wunschdenken, wenn es um die Beweise in eigener Sache geht.
Wenn sich Goyon auf Chevrier beruft, um den Reibungskoeffizienten weglassen zu können, hat es damit folgende Bewandtnis: Beeindruckt von der Darstellung des Statuentransportes von El Bersheh (Seite 169) wo eine Last von geschätzten 60 t von 172 Mann gezogen wird, stellte Chevrier einen Versuch an. Auf eine ebene Schleifbahn von nassem Lehm stellte er einen mit 6 Tonnen belasteten Schlitten und spannte eine Treidelmannschaft, meist Studenten, von 17 Mann davor. Kaum war die Totlage überwunden, purzelte diese Mannschaft hin, die auf eine schwere Dauerlast gefaßt war, so leicht bewegte sich der Schlitten. Es handelte sich hier um einige Meter. Der Vorgang ist bei einer geringen Last von 2—3 Tonnen auch auf längeren Strecken möglich. Die Lehm¬oder Schlammschicht wird von den schleifenden Kufen schon hier zur Seite gequetscht, der Druck von 60 t würde den Gleiteffekt aber sofort vernichten. Der Praktiker Chevrier zog aus seinem gelungenen Versuch auch keine weitreichenden Schlüsse, weil er sich bewußt war, daß die Sa¬che unter weniger günstigen Verhältnissen und besonders auf schiefen Ebenen nicht ebenso funktionieren kann.
Die Rundumrampen aus luftgetrockneten Nilschlammziegeln sind an sich bautechnisch in ihrer Stabilität sehr umstritten. Goyon denkt sie sich mit Hölzern oder Astwerk aus heimischem, also ägyptischem Wachstum schichtweise verstärkt und mit Holzbohlen, vielleicht von Palmen belegt, auf denen eine Schlammschicht den Zug erleichtern soll¬te. (Siehe Abb. Seite 79) Diese Schlammschicht jedoch trocknet sehr schnell aus, muß vor jedem Schlitten, auch wenn diese in Intervallen von nur 2—3 Minuten einander folgen, neu benetzt werden, wobei ein Teil des Wassers versickert. Wenn wir für die beiden breiten Kufen jedes Schlittens pro Zugmeter nur ein Achtelliter Wasser zur Benetzung an¬nehmen, wahrlich geringfügig, von dem noch die Hälfte verdunstet, so versickern immerhin in die 34 m lange Rampe, die bei ca. 6% Steigung nötig ist, um die zweite Steinlage von etwa 52.000 Steinen aufzubauen, ca. 220.0001 Wasser. Das heißt: in 250 m3 luftgetrockneten Nilschlamm sickern fortlaufend täglich ca. 1380 1 Wasser ein. Wie lange soll es bis zur Auflösung der Ziegelmasse dauern? Denn der Aufbau der Stufe dauert etwa 160 Tage!
Wenn Goyon aber die Schleifbahn so glitschig haben will, daß er auf jede Reibung verzichten kann, wäre natürlich sehr viel mehr Gießwasser anzunehmen. Fraglich, ob die zweite oder gar die dritte Steinlage noch fertiggebaut werden könnten.
Eine etwas bizarre Rechnung stellt Gaade Hansen an. Er sagt, daß eine 1460 m lange Rampe, mit der man von oben her die Spitze der Che-opspyramide hätte erreichen können, 17.373 Millionen m3 Material ver¬schlingen würde, also das 7,6-fache des Pyramiden-Volumens, die aber aus Sand unstabil wäre. Zur Aufschüttung errechnet er 300.000 Arbei¬ter, die jedoch während der 4. Dynastie nicht zur Verfügung stehen konnten, da man mit einer Gesamtbevölkerung Ägyptens von 1, höch¬stens 2 Millionen rechnen durfte. Also wäre eine solche Rampe unmög¬lich gewesen. .
Dazu muß angeführt werden, daß es durch die Pyramidenbauten zu einem Arbeitermangel kam. Zur Behebung führte Snofru Razzien in
Nubien durch. Dabei sind, wie belegt ist, einmal 17.000 Gefangene ein¬gebracht worden, die auf den Gütern als Fremdarbeiter eingesetzt, aber dann bald integriert wurden.
Außer dem Zusammenhang sei hier angeführt, was vor einiger Zeit möglicherweise als sommerlicher Spaltenfüller in einigen Zeitungen
über den wahren Sinn der Pyramiden zu lesen stand. Sie sollen als Was¬serspender funktioniert haben, dadurch, daß der in diesen Gebieten reichliche Tau an den Wänden kondensierte und das Wasser dann ge¬sammelt werden konnte. Nun kühlen die Wände des nachts nicht genü¬gend ab, auch die Nordwand kaum, um eine Kondensation zu ermögli¬chen. Außerdem gab es im damaligen Ägypten keinen Wassermangel, da das Nilwasser gerne getrunken wurde, dem man sogar bis in späteste Zeit Heilkräfte zugeschrieben hat. Einige Forscher berichteten, daß es für sie geradezu ein Erlebnis gewesen ist, endlich Nilwasser zu trinken! Heute wäre das Erlebnis nicht mehr ganz so groß! Jedoch besteht die Wasserversorgung aus gereinigtem Nilwasser. Im Fayum sprudelt die einzige mineralhaltige Quelle.
Zum Spitzenausbau der Cheopspyramide schlägt Prof. Arnold, der die Spiralrampe des Goyon ablehnt und scheinbar eher an eine Ram¬pe von Lauer denkt, für die Aufbringung des Pyramidions, das er mit 7 Tonnen annimmt, die Anbringung einer Holzplattform rund um die Py¬ramidenspitze vor, auf der die Bauleute genügend Bewegungsfreiheit haben konnten, etwa wieder in Anlehnung an den Überbau, den Lauer annimmt. Jedoch hat die Schwierigkeit des Spitzenausbaues nicht nur in der Aufbringung des Pyramidions bestanden.
Kurz vor Drucklegung dieses Buches tauchte in der „Gazette" der „Wiener Arbeiterzeitung" vom 19. 4. 84 eine aufwendige Meldung auf: „Wiener Ägyptologe löst Rätsel um tonnenschwere Steinquader. Mit Schlitten zur Pyramidenspitze. Eines der großen Geheimnisse der alt¬ägyptischen Pyramiden-Baumeister — wie tonnenschwere Steine bis zur Spitze der riesigen Bauwerke transportiert wurden — glaubt der Wiener Ägyptologie-Ordinarius Univ. Prof. Dr. Dieter Arnold gelöst zu haben: Man verwendete dazu wahrscheinlich schlittenartige Spezialfahrzeuge, mit denen die Quader auf eigens angelegten Treppen Stufe für Stufe 'hochgekippt' wurden. Und so dürfte der 'Steine-Heber' funktioniert haben: Er war ungefähr drei Meter lang und hatte nach unten gewölbte
Kufen. Mit Hilfe von Seilen konnte das Fahrzeug über die Treppen nach oben geschaukelt werden. Auf diese Weise haben die alten Ägypter die Hebelgesetze optimal ausgenutzt, meint Prof. Arnold. Er stützt sich bei seinen Forschungen auf bereits länger bekanntes Fundmaterial."
Es wird dabei offenbar auf ein „seltsames Gerät aus Holz" zurück¬gegriffen, des schon Champollion (1790—1832) aufgefunden hatte. Go-yon geht in seinem zitierten Werk auch darauf ein und steuert die hier wiedergegebene Zeichnung dazu bei. Sofort dachte man an die „Maschi¬ne aus kurzen Hölzern", von der Herodot berichtete, ohne Genaueres darüber aussagen zu können. Goyon schreibt über die Sache auf Seite 44 der deutschen Ausgabe: Wie sollten damit die 40-Tonnen-Blöcke trans¬portiert werden? Und er berechnet, daß es mindestens fünf Arbeitstage erfordert hätte, einen durchschnittlichen Stein auf die Höhe von 146 m zu heben. Täglich waren über 320 Steine zu transportieren, wieviele hät¬ten da arbeiten müssen, um die vorgegebene Bauzeit von 20 Jahren zu erreichen. (Hier soll aber angemerkt werden, daß es den Pharaonen durchaus eilig war, bei Lebzeiten ihre Pyramiden fertigzustellen. Die Lebenserwartung war im allgemeinen ziemlich kurz — für Könige stets sehr gefährdet, wie die Geschichte lehrt!) Da Stufen offen bleiben müßten, wie sollte man sie mit diesen Geräten im nachhinein, von oben nach unten, verbauen? Choisy schlägt schon (ca. 1904) den Einbau von Zwischenstufen aus Ziegeln vor. Er wendet sich dann selbst bald einer anderen Theorie zu. Goyon schließt seine ausführlichen Widerlegun¬gen: „Der berühmte Schaukelaufzug ist nur eine theoretische Vorstel¬lung." Allerdings widerlegt Goyon jede Bautheorie — außer seiner eige¬nen, die ja fürs erste bestechend aussieht. Doch das tun auch alle ande¬ren, zuletzt bleibt nichts übrig, was wahr oder wenigstens wahrschein¬lich sein könnte.
Aber immer wieder ist bei Rampentheorien die Rede von solchen Zie¬gelrampen. Auch Croon und zuletzt Lauer sprechen von einer Ziegel¬rampe. Diese Ziegel aus Nilschlamm sind mit einem Zwanzigstelanteil mit Häksei vermischt, was ihre Haltbarkeit steigert, wenn sie in der Son¬ne zu steinharten Stücken trocknen. Doch diese Ziegel nehmen natürlich Wasser wieder begierig auf. Das mußten die aus dem Überschwem¬mungsgebiet des Nasser-Stausees ausgesiedelten Nubier schmerzlich er¬fahren. Sie wurden in der Gegend von Kom-Ombo angesiedelt und bau¬ten dort ihre Häuser wieder aus Schlammziegeln, wie sie es in ihren früheren Wohngebieten getan hatten. In einem Wolkenbruch, wie solche im Gefolge des riesigen Stausees nun öfter auftreten, wurden ihre Häu¬ser wieder zu Schlamm. Ohne Bewässerung der Gleitbahnen ist der Schlittenzug auf einer Rampe undenkbar. Auch bei einer Unterlage von Palmholzbohlen, selbst von Steinplatten, würde ein Teil des Wassers versickern, das vor jedem Schlitten neu vor die Kufen gegossen werden müßte. So gering man auch die versickernde Menge annehmen will, bei der ungeheuren Zahl der Arbeitsvorgänge wäre es genug, um die Ziegel soweit zu sättigen, daß nicht einmal die zweite Baustufe fertiggestellt werden könnte. Wozu aber sollten Ziegelrampen gebaut werden, wenn soviel Abraum zur Verfügung stand, daß man sogar ohne verfestigte Böschungen die Rampe hätte aufschütten können. Dieses Material wäre durch die Durchfeuchtung höchstens bis zur Kompaktierung etwas ein¬gesunken.
Schleppzug auf trockenen Rampen, auf Holz oder Stein hätte die Treidlerzahlen sehr vergrößert und die Arbeitszeiten verlängert. Von Baurampen ist auch nichts überliefert. Daß man in Mirgissa Reste einer mit Holzbohlen ausgelegten Schleifbahn gefunden hat, auf der die Flachkielschiffe über Land gezogen wurden, um dem gefährlichen 2. Katarakt auszuweichen, wird oftmals als Beweis für Baurampen darge¬stellt. Damit wird nur bewiesen, daß man Lasten geschleppt hatte, aber das war längst bekannt. Das scheint eher ein Beweis der peinlichen Be¬weisnot zu sein, mit der man (oder einige) an der Rampentheorie fest¬halten will. Herodot hätte von Rampen erfahren, wenn es welche gege¬ben hätte. Aber Herodot sagt: Hebemaschinen!
Daß Erich von Däniken an den Pyramiden und an Ägypten nicht vor¬beikam, ist selbstverständlich. Zu den vielen Löchern, die eine exakte Wissenschaft in ihrem Forschungskatalog frühgeschichtlicher und vor¬geschichtlicher Baudenkmäler etc. offenlassen muß, hat Däniken den immer passenden Flicken darauf. Wenn man Besuche außerirdischer In¬telligenzen voraussetzt, die mit ihren alle irdischen Möglichkeiten weit überragenden Techniken immer wieder eingreifen, läuft die Sache eben. Wenn man einen pseudophilosophisch weitausholenden Satz bildet: „Unmöglich ist zuletzt nur, daß nicht alles möglich wäre" — dabei von Wahrscheinlichkeitserwägungen absieht, ist man Däniken wieder näher gekommen. Er kann sich auch darauf berufen, daß die rasante Entwick¬lung der Technik das Unmögliche immer weiter hinausschiebt und es heute Maschinen und Apparate gibt, von denen nur zu reden unsere Großeltern ins Irrenhaus gebracht hätte.
Was hat man nicht alles über den Pyramidenbau erzählt: Ahmet AI Maqrizi will wissen, daß die Steinmetzen auf die an der Ausbruchstelle fertig behauenen Quader „Zettel" geklebt haben, mit der genauen An¬gabe der Position beschriftet, die der Stein im Bau einnehmen sollte. Dann bekam er einen Stoß und flog viele Pfeilschußlängen hin, um sei¬nen Platz zu belegen.
Oder es wurde damit spekuliert, daß ein Gravitations-Fading in der Pyramidengegend bestanden haben könnte und diese Zeit für den Bau
für den Transport des Baumaterials von 2—70 Tonnen ausgenützt wor¬den ist. Auf ähnliche Weise hat man ja auch den Transport der Megali-the von Stonehenge zu erklären versucht, auch sie konnten fliegen und ihren Platz selber finden. Da befindet sich Däniken in bester Gesell¬schaft, ja er überragt sie noch meilenweit. Einige Kleinigkeiten in sei¬nem Buch „Erinnerungen an die Zukunft" zeigen jedoch einige Un¬kenntnis des immerhin vorhandenen festen Wissensbestandes: Der Zweifel, ob Holz importiert worden ist oder werden konnte (für den Py¬ramidenbau) ist durch den Palermostein eigentlich erledigt. Auch hat man Rad und Wagen schon sehr früh gekannt, jedoch aus praktischen Gegebenheiten nicht verwenden können. Däniken will auch den Pyrami¬denbau weit zurückdatieren und schreibt: „... dann gab es die Pyrami¬den lange, ehe Chufu seine Visitenkarten anbringen ließ". Nun ist Chu-fus Visitenkarte jedoch in der obersten Entlastungskammer über der Königskammer gefunden worden, die nach Fertigstellung der betreffen¬den Bauschicht (Steinschicht) nicht mehr zugänglich war — bis sie aufgesprengt worden ist. Das war aber 4000 Jahre später.
Streit über Datierungen des Pyramidenbaues hat es schon immer ge¬geben, da muß Däniken nicht wieder den sagenhaften König Surid be¬mühen, der schon vor der Sintflut die Pyramiden bauen ließ. Er wußte auch nicht, als er sein Buch schrieb, daß beim letzten Ägyptologenkon-greß in Basel (1982) alle Datierungen wieder in Frage gestellt worden sind, weil Fehler in der Sothis-Berechnung aufgedeckt wurden.
Daß keine der ihm bekannt gewordenen Erklärungen „kritischer Be¬trachtung standhält", ist wieder eine schon oft geäußerte Meinung. Schuld daran sind aber die Pyramidologen, die keinerlei technische Maschinen, z.B. Seilwinden, beim Bau der Pyramiden wahrhaben wol-
len. Weil man sie ihnen nicht aufgezeichnet oder zur Ausgrabung bereit¬gelegt hatte. Es bringt jedoch nichts, wenn bei Hellmut Müller—Feld¬mann „Waren die Götter Astronauten?", (ECON 1970) ineiner Widerle¬gung der Theorien Dänikens zu lesen ist, daß man „jetzt eindeutige Vorstellungen über den Pyramidenbau" hätte. Da werden wieder die Rampen aus „Abfallsteinen" rund um die Pyramide angeführt — oft¬mals bezweifelt und abgelehnt. Oder, nicht ganz verständlich, wird ge¬sagt: „Beim Bau der Cheopspyr. nahm man als Kern das vorhandene Felsgestein und füllte es mit Baumaterialien aus der nächsten Umgebung aus." Für Leser, die nicht mit der Frage vertraut sind, ist das mißver¬ständlich. Oder: „In diesen Zeiten auch, wo die Nilfluten bis an den Rand des Pyramidenplateaus heranspülten, wurden die Steinquader bis an den Bauplatz herangefahren, am Taltempel registriert und den Auf¬weg bis an den Pyramidenbau auf Rollen weiter hinauf transportiert."
Da sind mehrere Fehler enthalten. Abgesehen davon, daß offenbar hier wieder der Taltempel zur Cheopspyramide gemeint sein wird, durch den man da mit Mühe, um ihn nicht zu beschädigen, Riesensteine durchschleusen sollte, gab es in dieser Bauperiode noch keinen Taltem¬pel, auch nicht am Aufweg zum Materialplatz der späteren Chefrenpy¬ramide, über den zweifellos alle Transporte gegangen sind. Die dort be¬findliche Verladerampe konnte nur bei Normalwasser erreicht werden und stand bei Flut unter Wasser, das weit darüber hinauf ins Gelände reichte und jede Ablademöglichkeit ausschloß. Die Taltempel befanden sich auch nicht am Rand des Pyramidenplateaus, sondern unten am Ka¬nalufer. Dann heißt es weiter: „Engelhard konnte berechnen, daß die Menschenkraft von mehr als 5000 Leuten nötig war, um den unten los¬gelösten 41,75 m langen und 1168 engl. Tonnen wiegenden Monolithen erst einmal zur Seite zu legen und ihm feste Palmfaserstricke zum He¬rausheben anzulegen. Die Kraft von weiteren zusätzlichen 3000 Mann war nötig, um ihn dann zum Weitertransport aus dem Steinbruch zu he¬ben." Es ist wohl die Rede von dem noch in situ befindlichen, ange¬brochenen Obelisken im Granitsteinbruch von Assuan.
Engelhard in Ehren, aber wie hätte man 8000 Mann überhaupt einset¬zen können? Nämlich überhaupt nicht und besonders an dem angespro¬chenen Lageplatz auf keinen Fall! Und wozu sollte man den Obelisken, „...der unten losgelöst war", erst zur Seite legen, da doch unten viel Platz gewesen ist, um Seile zu legen? Und warum Palmfaserstricke? Es gab doch längst Hanfseile, mit denen man nicht sparte. Großflächiger Hanfanbau ist erwiesen (Cheops' Totenbarke).
Man konnte den Obelisken nur auf einem Drehpunkte herausdrehen, dabei hätte man höchstens ein Drittel seines Gewichtes bewegen müssen. Auf vorbereitetem (Stein)weg konnte er dann zum Nil zur Verladung gebracht werden. Ein „Herausheben" war nicht nur unmöglich, son¬dern auch überflüssig. Es nützt auch wenig, wenn man Menschenkraft einfach multipliziert, ohne den notwendigen Raum zum Einsatz zu ha¬ben. Hätten die Ägypter keine besseren Ideen zum Transport eines Obe¬lisken gehabt, hätten sie nie welche aufgestellt!
Mit widerlegbaren Widerlegungen kommt man nicht voran, da ist schon fast Däniken vorzuziehen — den man ja mit letzter Gewißheit nicht widerlegen kann. Darauf ist ja seine ganze Schreibweise ausgerich¬tet ! Den wird es auch nicht vom Sessel reißen, wenn es dann noch heißt: „Auch in den ägyptischen Mythen findet sich kein Hinweis für den Be¬such von Astronauten..." Von Astronauten wohl nicht, jedoch wurde täglich und nächtlich viel herumgeflogen. Die verstorbenen Herrscher erobern im AR in Personalunion mit Osiris den Himmel. Heliopolis gab dem Osiris außerirdische Erscheinungsformen: Er ist der Orion, der Mond, die nächtlich verborgene Sonne, es gibt beflügelte Göttinen, den Ba-Vogel u.a.m. Aus solchen Mythen kann ein Däniken, der immer auf der Suche nach Beweisen für seine außerirdischen Gäste ist, oder aus uraltem Sagengut oder unübersetzbaren Texten aus Totenpapyri seine Vorstellungen begründen.
Und damit rundet sich dieses Kapitel zwischen zwei unsinnigen Aus¬sagen zum Pyramidenbau ab: Die Salzrampen des Livius und die Extra¬terrestrischen des Däniken. Wunder sind Plunder und hier gar nicht ge¬fragt ! Menschliches Ingenium hat ausgereicht, diese Bauten aufzurich¬ten. Solange es Menschen gibt, haben sie sich Werkzeuge ersonnen, um ihre geringe Kraft besser einsetzen zu können, sich Energie zu gewinnen zur Bewältigung der Umwelterfordernisse, und das Überleben einer sich stetig vervielfachenden Menschheit ist letzten Endes eine Frage der Energiegewinnung. Das Wohlstandsgefälle der Menschheit ist stets eine Energiefrage gewesen. Energiegewinn brachte Zivilisation, Energieüber¬schuß erst brachte Muße zur Kultur.
Schon zur Zeit der Pyramidenbauer war Ägypten, „das Geschenk des Nils", altes Kulturland. Seine wirtschaftliche, politische und kulturelle Konsilidierung war ein „Geschenk des Nordwindes", vor den man bald Segel zu setzen gelernt hatte und so den Fluß aufwärts und abwärts nutzen konnte.

Position & Funktion der Cheops Pyramide
in Pyramiden - Cheopspyramide 04.09.2018 09:56von Simbelmyne • 32.666 Beiträge

Sternencode in den Pyramiden ?
in Pyramiden - Cheopspyramide 13.09.2018 10:54von Simbelmyne • 32.666 Beiträge

Sternencode in den Pyramiden ?
Was ist die Bedeutung der Pyramiden im alten Königreich Ägyptens? Welcher Zweck wurde mit ihrem Bau verfolgt? Wes¬halb findet man in ihnen tief liegende, ausgedehnte Tunnel¬systeme, lange, enge Schächte, die nirgendwohin zu führen scheinen, sowie Gänge, Galerien und Kammern, die meist kahl und leer sind? Warum waren die Pyramiden astronomisch nach den Sternen ausgerichtet? Warum sind sie grüppchenweise über einen 40 Kilometer langen Wüstenstreifen verstreut? Und was noch faszinierender ist: Warum sind einige von ihnen frei von Inschriften, während bei anderen die Wände vollgeschrieben sind mit Texten, die von der Sonne und den Sternen handeln sowie von der seltsamen religiösen Kosmologie einer Himmels¬region, die an Ägypten selbst erinnert?
Bis vor Kurzem besagte die gängige Theorie der Ägyptologen, die Pyramiden seien Grabstätten, riesige Mausoleen, die in erster Linie erbaut wurden, um den Leichnam eines verstorbenen Königs zu beherbergen. Was die ausgeklügelten Systeme von Tunneln, Schächten, Gängen und Kammern betrifft, so seien sie hauptsächlich dazu angelegt worden, um Grabräuber hinters Licht zu führen, und die astronomische Ausrichtung der Bauten sei entweder bedeutungslos oder reiner Zufall. Erstaunlicher¬weise konnten sich diese Ansichten fast zwei Jahrhunderte lang praktisch unangefochten halten, und das trotz der ärgerlichen Tatsache, dass keinerlei Leichname von Königen (noch nicht einmal ein Skelett, ein Schädel oder ein Knochensplitter) jemals in einer der Pyramiden gefunden wurden.
Was noch peinlicher ist: Niemand hatte eine Erklärung dafür, warum diese Pyramiden, wenn sie doch Grabstätten waren, nicht in Form eines klar umrissenen Friedhofs angelegt worden waren, sondern grüppchenweise verstreut in der Wüstenebene westlich des Nils, wie bizarre Vulkaninseln in einem Meer aus Sand. Doch seltsamerweise gibt es mehr als genug Hinweise auf einen viel höheren Zweck der Pyramiden, als einfach als Grab¬stätten zu dienen. Diese Hinweise waren schon immer für jeden sichtbar, und sie verweisen sogar sehr deutlich auf einen Bezug zu den Sternen. Zum Beispiel:
1) Das Fundament jeder Pyramide ist der astronomischen Ausrichtung von Sternen angepasst.
2) Die größte der Pyramiden, die Pyramide des Königs Khufu in Giza, enthält »Luftschächte«, die auf wichtige Stern¬formationen gerichtet sind, wie Orion, Sirius und die zirkumpolaren Konstellationen.
3) Einige Pyramiden wurden direkt nach Sternen benannt oder erhielten einen Namen, der auf einen Stern hindeu¬tete (»Die Pyramide des Djedefre ist ein Sehedu-Stern«; »Nebka ist ein Stern«; »Horus ist der Stern am Scheitel des Himmels« usw.).
4) Die Kammerdecken einiger Pyramiden sind mit fünf¬zackigen Sternen verziert (zum Beispiel die Stufenpyrami¬de sowie Pyramiden der fünften und sechsten Dynastie in Sakkara).
5) Bei einigen Pyramiden (denen der fünften und sechsten Dynastie in Sakkara) sind auf den Innenwänden Inschrif¬ten eingemeißelt, in denen von einer Sternenwelt namens Duat die Rede ist, zu der Orion und andere Konstellatio¬nen gehören.
Es erscheint daher schon etwas seltsam, um nicht zu sagen widersinnig, dass angesichts so vieler Sternspuren kein einziger Ägyptologe auf den Gedanken gekommen ist, eine stellare »Funk¬tion« der Pyramiden in Betracht zu ziehen. Und weil dieses wichtige Thema so lange auf Eis lag, ist es nicht verwunderlich, dass ungeschulte Forscher, Dilettanten, Sonderlinge und Schar¬latane lächerliche, abstruse und völlig verrückte Theorien in die Welt setzten: Die Pyramiden wurden von der untergegangenen Atlantis-Zivilisation erbaut; sie wurden mithilfe einer vergesse¬nen Levitationstechnik errichtet; sie waren Kraftwerke; sie waren elektromagnetische Empfänger eines kosmischen Kommunikati¬onssystems; sie wurden von Außerirdischen errichtet; sie wurden von den Juden während ihrer Gefangenschaft in Ägypten erbaut; bei der Konstruktion der Großen Pyramide wurden in jedem Zoll der Planung bewusst detaillierte Informationen der Weltge¬schichte und der Zukunft gespeichert; die Große Pyramide ist eine in Stein gehauene Bibel.
Ais ich dann 1994 mit meinem Buch Das Geheimnis des Orion herauskam und darauf hinwies, dass die Anordnung der drei Giza-Pyramiden und ihre Stellung zum Nil der Anordnung der drei Sterne des Orion-Gürtels in ihrer Stellung zur Milchstraße entsprechen, war das Thema bereits dermaßen in den Dreck gezogen worden, dass jede Theorie, in der auch nur die Begriffe »Sterne« und »Astronomie« vorkamen, sogleich auf eine Wand wissenschaftlicher Gleichgültigkeit stieß (im günstigsten Fall) oder lautstark angegriffen wurde. Die Reaktion fiel umso hitzi¬ger aus, denn einer der bedeutendsten und berühmtesten Ägyp-tologen gab meiner Theorie Rückendeckung, wenn auch in vorsichtigen Tönen: Sir I. E. S. Edwards. Er legte für mich tapfer und edelmütig die Hand ins Feuer, indem er sich für den 1994 von der BBC2 gezeigten Dokumentarfilm The Great Pyramids — Gateway to the Stars interviewen ließ und einige meiner Ideen unterstützte.
Das brachte ihm den Zorn seiner Fachkollegen ein, aber dennoch sahen sich einige von ihnen zähneknirschend dazu gezwungen, meine Theorie zu rezensieren. In den Jahren danach jedoch, und besonders nach Edwards Tod 1996, wurde ich durch eine von Ägyptologen und anderen »Experten« inszenierte Kabale verspottet und an den Pranger gestellt. Diese Leute hatten es offenbar darauf abgesehen, meine nun »Orion-Theo¬rie« genannte Hypothese als unsinnig zu entlarven. Diese akade¬mische Attacke war sehr entmutigend und bedauerlich, aber ich behauptete mich beharrlich, wusste ich doch, dass ich nicht nur großes Interesse und wohlmeinenden Beistand in der breiten Öffentlichkeit und bei den internationalen Medien erweckt hat¬te, sondern auch, dass die von mir vorgelegte Theorie sich nahtlos in das Umfeld der ägyptischen Pyramiden einfügte und das fehlende Glied in dem ansonsten rätselhaften Mysterium darstellte. Selbst der eingefleischteste Skeptiker konnte den Orion-Giza-Zusammenhang nicht ohne Weiteres von der Hand weisen.
14 lange Jahre sind nun seit der Veröffentlichung von Das Geheimnis des Orion vergangen. Inzwischen ist das Buch in mehr als 20 Sprachen veröffentlicht worden, und Dutzende von Do¬kumentarfilmen auf der Grundlage der Orion-Theorie wurden im Fernsehen ausgestrahlt (zum Beispiel in England: BBC2 und Channel 4; in Amerika: ABC, NBC und FOX; Europa und Amerika: Discovery Channel; Italien: RAI 3; Deutschland: ZDF und ARD; Frankreich: ARTE und TF3; Südafrika: SABC und M-net TV; Holland: AVRO TV; Australien: Channel 7; Ägypten: NILE-TV; sowie viele andere Kanäle im Fernen und Mittleren Osten).
Zwei weitere Dokumentarfilme wurden vom National Geo¬graphie TV ausgestrahlt, beide unter dem Titel Unsolved Mysteries ofthe Pyramids (wobei meine Theorien kritisch betrachtet wur¬den), sowie ein weiterer namens Egypt Decoded, produziert für Italiens Sender RAI 2 sowie Hollands AVRO und vollständig auf meinem Buch Der Ägypten-Code beruhend. Langsam, aber si¬cher hat sich die Theorie der Pyramiden-Orion-Korrelation wie ein nächtlicher Dieb in die Hauptströmung der Ägyptologie und die neue Disziplin der Archäoastronomie eingeschlichen. Und obwohl sie mit viel Kritik bedacht wird, hat sie unübersehbar den sprichwörtlichen Nerv der Wissenschaft getroffen.
Allerdings muss man fairerweise auch erwähnen, dass nicht alle Akademiker Das Geheimnis des Orion von vornherein ab¬lehnten. Einige bedeutende Ägyptologen, wie Dr. Jaromir Malek vom Grijftth Institute und der amerikanische Ägyptologe Dr. Ed Meltzer, haben sich ihre Unvoreingenommenheit bewahrt, ge¬nau wie es Sir I. E. S. Edwards getan hatte. Positiv zu erwähnen ist auch, dass die Theorie von astronomischen Kreisen verhalten befürwortet wurde, insbesondere von Professor Archie Roy von der Glasgow University, Professorin Mary Brück von der Edinburgh University, Professor Giulio Magli vom Politecnico di Milano, Professor Percy Seymour von der Plymouth University und Professor Chandra Wikramasinghe von der Cardiff Univer¬sity. Und obwohl sich diese hochrangigen Astronomen eine ge¬sunde Portion Skepsis vorbehielten, waren sie von der Theorie fasziniert und befanden, dass sie sorgfältige Betrachtung und weitere Forschung verdiene.
Im Laufe der Jahre zeichnete sich außerdem ein Riss im Panzer der akademischen Ägyptologie ab, nachdem sich Dr. Jaro¬mir Malek (der meine Theorie 1994 im Oxford-)oumA Discus-sions in Egyptology rezensierte) für die Möglichkeit ausgespro¬chen hatte, dass die scheinbar unlogische Streuung der Pyrami¬den in der Nekropole von Memphis (einem 40 Kilometer langen Wüstenstreifen westlich des Nils unweit von Kairo) letztlich doch mehr »mit religiösen, astronomischen oder ähnlichen« Erwägungen als mit rein praktischen Erwägungen wie den topografischen und geologischen Gegebenheiten der Landschaft zu tun habe. Ähnliche Ansichten wurden von anderen Ägyptolo¬gen geäußert, so vom amerikanischen Ägyptologen Mark Leh¬ner, dem tschechischen Ägyptologen Miroslav Verner und dem britischen Ägyptologen David Jeffreys.
Es war jedoch der Archäoastronom Anthony Aveni, Professor für Astronomie und Anthropologie an der Colgate University, dem es aus meiner Sicht am ehesten glückte, ein Gesamtbild dessen zu erstellen, was die antiken Architekten im Auge hatten, die derartige mysteriöse Monumente entwarfen und planten (nicht nur in Ägypten, sondern auch in anderen Teilen der Welt). Er schrieb: »Um zu verstehen, was die Menschen in der Antike über ihre Umwelt dachten, müssen wir zunächst lernen, die sich ihnen darbietenden Phänomene durch ihre Augen wahr¬zunehmen. Ein Verständnis von der jeweiligen Kultur ist not¬wendig, aber auch das Wissen, wie der damalige Himmel aussah und wie sich die Himmelsobjekte bewegten, ist unabdingbar ..., denn es ist seltsam, aber wahr: Ganze Städte, Königreiche und Imperien wurden auf der Grundlage von Beobachtungen und Interpretationen von Naturereignissen erbaut, die unentdeckt vor unserer Nase und über unseren Köpfen vorüberziehen.«
Dr. Aveni bezog sich auf die Zivilisationen der Maya und der Inka, als er die obige Aussage machte - aber er könnte genauso gut auch über das alte Königreich Ägypten gesprochen haben, denn ich bin jetzt mehr denn je davon überzeugt, dass eine solche Aussage noch besser auf die heiligen Städte, Pyramiden und Tempel zutrifft, die von den alten Ägyptern während ihrer 3000-jährigen Zivilisation entlang des 1000 Kilometer langen Niltals errichtet wurden. Und genau dies ist eine Kurzzusammen¬fassung dessen, was ich in Der Ägypten-Code darzulegen versuchte.
Im Jahr 2000 war ich bereit, die Erkenntnisse meiner For¬schung in Buchform zu fassen. Zu diesem Zweck legte ich meinem Lektor bei Random House in London eine Synopse vor, der mir für das Projekt prompt einen Auftrag erteilte. Anfang 2004 lag mein erster Entwurf vor. Die Reinschrift des Manu¬skripts jedoch stellte ich in Ägypten fertig: Im Februar 2005 mietete ich eine vollmöblierte Wohnung mit Ausblick auf die Giza-Pyramiden. Meine Anwesenheit dort gab mir die einzigar¬tige Möglichkeit, mein Buch in greifbarer Nähe zu den Pyramiden Unterägyptens und den großen Tempeln Oberägyptens zu überarbeiten und die meiner These zugrunde liegenden Ideen zu prüfen und zu verifizieren. Inspiriert durch den Reiz und den Zauber dieser alten Monumentalanlagen ist es mir, so glaube ich, auf unterschiedliche Weise gelungen, die Theorie der Himmel-Erde-Korrelation, die ich vor zwei Jahrzehnten entwickelt hatte, zu einem angemessenen Abschluss zu bringen.
Für Der Ägypten-Code habe ich so weit wie möglich Primär¬quellen verwendet und mich ausschließlich auf wissenschaftliche Forschungsberichte gestützt, die entweder in von Experten be¬gutachteten Journalen oder in Fachbüchern renommierter Ägyp-tologen oder anderer namhafter Wissenschaftler veröffentlicht worden waren. Diesem Standard fühle ich mich meinen Lesern gegenüber verpflichtet. Anhand dieses ausgesuchten Quellenma¬terials bin ich zu folgendem Schluss gekommen: Die ägyptische Theokratie richtete sich nach einer kosmischen Weltordnung namens Ma at, was nichts anderes war als die Weltordnung des Himmels: die sichtbaren, präzisen und berechenbaren Zyklen der Sonne, des Mondes und der Sterne. Ich bin ferner zu dem Schluss gekommen, dass der inbrünstige Glaube herrschte, diese kosmische Weltordnung beeinflusse die irdische Welt, insbeson¬dere die enorm wichtige jährliche Nilüberschwemmung, denn nichts faszinierte, beeindruckte und ängstigte die alten Ägypter mehr als die Überschwemmung des Nils, die im Juni begann und im September endete. Dies war das jährliche Wunder, das entweder den Ackerboden und alles andere Leben in Ägypten regenerierte oder aber zu Hungersnot und Pest führte, wenn die Flut ausblieb.
Durch dieses zweischneidige Schwert, das ständig über Ägyp¬ten hing, sahen sich die Bewohner des Niltals genötigt, nach magischen Mitteln Ausschau zu halten, um eine gute Über¬schwemmung zu gewährleisten. Bereits in ihrer frühen Entwick¬lung beobachteten sie, dass die Sterne des Orion und Sirius im späten März nach Sonnenuntergang hinter dem westlichen Horizont verschwanden und für längere Zeit (etwa drei Monate) in der »Unterwelt« verblieben, ehe sie im späten Juni in der Mor¬gendämmerung wieder am östlichen Horizont auftauchten, ge¬nau zu dem Zeitpunkt, als das Wasser des Nils zu steigen begann. Während dieser kritischen Zeit des Aufenthalts der Sterne in der »Unterwelt« fiel den Priesterastronomen auch auf, dass die Son¬ne sich auf ihrer Reise entlang der Ekliptik von einem bestimm¬ten Punkt unterhalb der hellen Plejaden (dem Frühlingspunkt) zu einer Stelle bewegte, die unterhalb der Brust des Sternbilds Löwe (Leo) liegt (dem Punkt der Sommersonnenwende), wo¬durch die Konstellation von Orion und Sirius eingeklammert wurde.
Sie kamen auf die Idee, dass der Sonnengott, während er jenen besonderen Teil des Himmels — die sogenannte Duat -durchkreuzte, ein magisches Ritual vollführte, eine Art Kreuz¬weg, der die »Wiedergeburt« der Sterne zur Folge hatte und auch die »Wiedergeburt« des Nils, wenn Ende Juni der Stern Sirius im Morgengrauen wieder am östlichen Horizont auftauchte. Auch dieses Ereignis fiel auf den Tag der Sommersonnenwende, an dem die Sonne ihre maximale nördliche Deklination erreichte, und wurde aus gutem Grunde als Neujahrstag festgelegt. Es wurde (unter anderem) die »Geburt von Ra«, dem Sonnengott, genannt.
Eine Mythologie und Himmelsreligion entwickelte sich um diese auf den Kosmos und den Nil bezogene Thematik, und -was noch faszinierender ist - um 2800 v. Chr. wurde ein ehrgei¬ziger Plan ausgeklügelt, um die kosmische Ordnung im wahrsten Sinne des Wortes »herabzubringen«, sodass der Pharao, der Sohn des Gottes Ra und der Erde, die gleiche Reise in einer irdischen Duat durchführen und somit für Ägypten eine »gute« Über¬schwemmung herbeiführen konnte (man erinnere sich an das hermetische Gesetz: wie oben, so unten). Zu diesem Zweck wurde ein gewaltiges, generationenübergreifendes Projekt ins Leben gerufen. Dabei war vorgesehen, dass an vorherbestimmten Orten Gruppen von »Sternen«-Pyramiden erbaut wurden, die Orion und die Plejaden verkörperten. Auch der Bau von »Son-nen«-Tempeln zu beiden Ufern des Nils gehörte dazu, die jenen Teil der Ekliptik nachzeichneten, den der Sonnengott vom Frühlingspunkt bis zur Sommersonnenwende durchläuft, die zu beiden Seiten der Milchstraße gelegen sind.
Neue Theorien hören damit nicht auf ! die langsamen zyklischen Veränderungen in der Himmelslandschaft, die im Laufe der 3000 Jahre der pharaonischen Zivilisation durch Präzession und durch die Eigenheiten des ägyptischen Zivilkalenders hervorgerufen wurden,welche sich in den Veränderungen auf dem Boden ent¬lang des 1000 Kilometer langen Niltals widerspiegeln, und zwar in Bezug auf den Werdegang der Tempel in den gleichen 3000 Jahren. Mit anderen Worten, Der Ägypten-Code behauptet nicht weniger, als den Beweis zu erbringen, dass es ein »kosmi¬sches Ägypten« gibt, das in der geografischen Struktur des von Norden nach Süden verlaufenden Niltals umherspukt und das einst von Priesterastronomen unter der Leitung eines Sonnen¬königs verwaltet wurde; dass dieses kosmische Ägypten für mehr als 3000 Jahre währte und dass es noch heute anhand der Lage der Pyramiden und Tempel wahrgenommen werden kann.

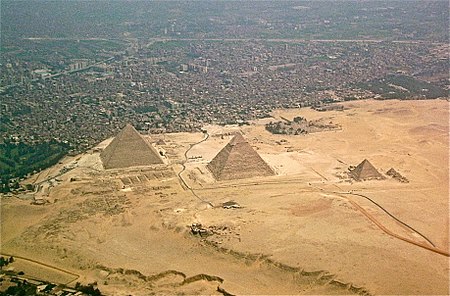
Seit Langem herrscht in der orthodoxen Ägyptologie die Ansicht, dass die Wahl des Bauplatzes für die Hauptpyramiden in Giza allein aufgrund der Wünsche des betreffenden Pharaos sowie logistischer Gegebenheiten und anderer praktischer Erwä¬gungen hinsichtlich des jeweiligen Geländes getroffen wurde. Weiterhin glaubt man, bei der Entscheidung des Königs für die Lage seiner Pyramide hätten Überlegungen zu eventuell vorher errichteten oder später zu errichtenden Bauten fast keine oder gar keine Rolle gespielt. Jede der Giza-Pyramiden — so der herkömmliche Standpunkt - wurde von den aufeinanderfolgen¬den Pharaonen als separates königliches Grabdenkmal errichtet, und zwar ohne Bezug zu einem langfristigen Gesamtbauplan. Kurzum, man will uns glauben machen, die Giza-Pyramiden seien ohne Bezug zueinander errichtet worden und es habe keinen übergreifenden architektonischen Plan gegeben.
Diese gängige Sichtweise hinsichtlich der Pyramiden auf dem Giza-Plateau widerspricht den Schlussfolgerungen der Arbeit Robert Bauvals, der 1994, gemeinsam mit Adrian Gilbert, sein erstes Buch veröffentlichte - Das Geheimnis des Orion. Die Autoren vertraten die radikale Hypothese, die Giza-Pyramiden seien als symbolische Repräsentation der drei Sterne des Orion Gürtels errichtet worden. Durch das Verkünden dieser Hypo¬these beschwor Bauval die schon fast häretische Vorstellung herauf, jede der Giza-Pyramiden sei als Komponente eines lang¬fristigen Projekts konstruiert worden: eines generationenüber¬greifenden Bauplans, der die Gürtelsterne des Sternbilds Orion mit einbezieht.
Es überrascht kaum, dass Bauval mit seiner kühnen Hypothe¬se die geballte Wut des akademischen Establishments auf sich zog. Mit nur wenigen namhaften Ausnahmen ließen sich die Agyptologen von Bauvals Ansatz nicht überzeugen und wiesen die von ihm zitierten altägyptischen Schriften, die sogenannten Pyramidentexte, als Nachweis für seine Hypothese von der Hand, obwohl es dort eine ganze Reihe von Textstellen gibt, die seine Arbeit in beträchtlichem Maße untermauern. Die Agyptologen forderten von Bauval, schlüssige Beweise für seine Orion-Hypo¬these zu liefern, ehe sie auch nur entfernt in Betracht zögen, eine mehr als 100-jährige Tradition über den Haufen zu werfen, nach der man eisern auf dem Standpunkt beharrt, die Giza-Pyrami¬den seien drei separate königliche Grabmäler, die unabhängig voneinander erbaut wurden.
Robert Bauval jedoch bleibt seiner Sichtweise treu. Fast 15 Jahre nach Erscheinen von Das Geheimnis des Orion traf ich mich mit Bauval im Schatten der Großen Pyramide und fragte ihn nach seiner Meinung bezüglich einer ganz offensichtlichen Anomalie in Giza: »Wenn Khufu der erste Pharao der Vierten Dynastie war, der in Giza baute«, so fragte ich, »warum hat er seine Große Pyramide dann nicht auf dem repräsentativen, hoch gelegenen Baugrund in der Mitte des Plateaus errichtet?«
Bauval schaute mich mit seinem typisch hintergründigen Lächeln an und antwortete: »Weil ... Scott, es hat einen Plan gegeben.«
In Keeper of the SphinxIMessage of the Sphinx erklären die Autoren überzeugend, dass dieser »Generalplan« wahrscheinlich auch die Große Sphinx von Giza beinhaltete, die nach ihrer Hypothese als eine Repräsentation des Sternbilds Löwe am östli¬chen Himmel um 10 500 v. Chr. entworfen worden sein könnte. Anscheinend benutzten die Erbauer der Großen Sphinx das Sternbild Löwe als Vorlage für dieses obskurste aller Giza-Monu-mente. Könnte es so gesehen nicht auch möglich sein, dass die Planer die Gürtelsterne des Orion nicht bloß als Muster heran¬zogen, um die Pyramiden in fast identischem Muster auf irdi¬schem Boden zu erbauen, sondern auch, um die Gürtelsterne als zugrunde liegende Vorlage zu benutzen, um auf die tatsächlichen Maßverhältnisse der Fundamente - die Grundrisse - aller drei Hauptpyramiden von Giza zu kommen?
Es versteht sich eigentlich fast von selbst, aber wenn sich nachweisen lässt, dass die Gürtelsterne des Orion in der Tat dazu benutzt werden können, um problemlos drei Flächen zu generie¬ren, deren Maßverhältnisse denen aller drei Hauptpyramiden von Giza gleichen, so ließe sich damit Bauvals Orion-Hypothese stark untermauern.
Aber ist das machbar? Ist es möglich, dass sich anhand der drei Gürtelsterne des Orion - durch die Anwendung einer sehr einfachen geometrischen Technik - drei Grundrisse errechnen lassen, die genau den Grundflächen der drei großen Giza-Pyra-miden entsprechen? Wir werden demnächst auf diese Frage zurückkommen, doch zunächst wollen wir uns ein paar weitere »Anomalien« in Giza anschauen, für die es keine überzeugende konventionelle Erklärung gibt.
Anomalien zuhauf
Wie bereits erwähnt: Wenn der letzte Ruheort des Pharao ein¬fach auf seiner persönlichen Wahl basiert, dann müssen wir uns fragen, wieso Khufu für die Lage seiner Großen Pyramide die äußerste Ecke im Nordosten des Giza-Plateaus aussuchte. Auf den ersten Blick scheint das vielleicht keine besonders seltsame Wahl gewesen zu sein. Schauen wir jedoch genauer hin, so fällt auf, dass das dominierende, erhabene Gelände in der Mitte des Plateaus liegt, wo Khafres Pyramide steht. Nicht nur, dass dieses die zentrale Region das beherrschende Gelände des Plateaus ist, es profitiert auch von dem »natürlichen Aufweg«, der vom Gelände der Sphinx zur Ostseite von Khafres Pyramide führt. Selbst heute noch wird diese Region von den Ägyptologen der »Torweg nach Giza« genannt.
Warum, so fragen wir, sollte Khufu sich für den Bau eines recht monumentalen künstlichen Aufwegs entschieden haben, der sich vom tiefen Tal hinaufwand, wo doch schon ein natür¬licher Aufweg hinauf zum dominierenden Gelände des Plateaus führte, der - hätte Khufu ihn für seine Zwecke genutzt — den beschwerlichen Bau seines Grabkomplexes erheblich vereinfacht hätte?
Indem Khufu es versäumte, das am höchsten gelegene Gelän¬de für sich selbst zu beanspruchen, hätte er sich außerdem darüber im Klaren sein müssen, dass er damit einem künftigen Pharao die Gelegenheit überließ, seine eigene Tat zu übertrump¬fen, indem dieser auf jenem Gelände eine höhere Pyramide erbaute. Genau dies sollte auch geschehen, denn Chafres Pyra¬mide sieht größer aus als die Große Pyramide, weil sie auf der zentralen Anhöhe des Plateaus errichtet wurde.
Die Ägypter waren in erster Linie sehr pragmatische Bau¬meister. Aus Khufus Sicht hätte es jeglicher Logik widerspro¬chen, sich dagegen zu entscheiden, seine Pyramide an der geeig¬netsten und repräsentativsten Stelle auf dem Plateau zu erbauen. Warum hätte Khufu es riskieren sollen, die Pracht seines eigenen Monuments von einem künftigen Pharao in den Schatten stellen zu lassen, indem er das beste Gelände außer Acht ließ? Das erscheint ganz und gar widersinnig.
Und wieso beschloss Khafre - der Erbauer der zweiten Giza-Pyramide - nach Giza zurückzukehren, wo sich doch sein Vor¬gänger, Djedefre, im Gegensatz zu dessen Vater Khufu nicht für Giza, sondern Abu Rawash als Baustelle für seine Pyramide entschieden hatte? Khafre war in der Tat der erste Pharao der Vierten Dynastie, der seine Pyramide in der Nachbarschaft der eines anderen Pharao (Khufu) errichtete. Warum beschlossen Khafre wie auch Menkaure, ihre Pyramide in Giza zu bauen, wo es doch aus religiöser Sicht folgerichtiger erschienen wäre, eine Nachbarschaft mit Djedefre (dem ersten König des aufstreben¬den Sonnenkults, bei dem der Name des Sonnengottes Re in die Königskartusche integriert wurde) bei Abu Rawash zu bevor¬zugen?
Schließlich wäre da noch Menkaures Pyramide - die kleinste der drei Giza-Pyramiden. Und erneut widerspräche es dem menschlichen Ur-Instinkt, dass Menkaure den Wunsch gehabt haben sollte, seine eigene, viel kleinere Pyramide im Schatten der Großen Pyramide und der Khafre-Pyramide zu errichten, wo ihre relativ kleine Größe durch die Nähe seiner beiden erhabe¬nen Nachbarn nur noch peinlicher wirken musste. Hätte Men¬kaure sein eigenes Monument an einer neuen, leeren Baustelle errichtet, dann hätte er seiner eigenen Pyramide das schmachvol¬le Schicksal ersparen können, das durch die Lage auf dem Giza-Plateau unvermeidlich war. Wieso hätte sich Menkaure für Giza entscheiden sollen in dem vollen Wissen, dass die von ihm geplante Pyramide für alle Zeiten mit der Schande behaftet wäre, die von seinen Vorgängern gesetzte hohe Norm verfehlt zu haben? Auch das ergäbe wenig Sinn.
Eine weitere offensichtliche Anomalie herrscht hinsichtlich der beiden Gruppen von jeweils drei »Königinnenpyramiden«. Drei von diesen Gebäuden verlaufen in nordsüdlicher Richtung an der Ostseite von Khufus Pyramide, während die andere Dreiergruppe in ostwestlicher Ausrichtung direkt südlich zur Menkaure-Pyramide gelegen ist.
Khafres Pyramide hat gar keine Königinnenpyramide. Was hat das zu bedeuten angesichts der bekannten Tatsache, dass Khafre fünf Frauen hatte? Also fünf Königinnen, und keine einzige Königinnenpyramide in der Nähe von Khafres Pyra¬mide! Diese Anomalie scheint jeder Logik und Vernunft zu entbehren.
All diese Anomalien und Widersprüche könnten freilich leicht erklärt werden, akzeptiert man die Existenz eines übergeordne¬ten Generalplans. Eines strikten Plans, zu dessen Einhaltung auf der Giza-Ebene sich die alten Ägypter der Vierten Dynastie -angefangen mit Khufu - »verpflichtet« fühlten.
Rein logisch gesehen war es sinnvoll, Khufus Pyramide zuerst zu erbauen, denn hätte man den Plan erfüllen wollen, indem man zuerst auf der zentral gelegenen Anhöhe gebaut hätte, so hätte man dem Bau späterer Monumente beträchtliche Hinder¬nisse in den Weg gelegt. Die Konstruktion musste in der Nord¬ost-Ecke des Plateaus beginnen, um der für spätere Bauten erforderlichen Logistik den nötigen Platz zu bieten. Angesichts der örtlichen Gegebenheiten hatte Khufu, der erste Bauherr in Giza, also einerseits keine andere Wahl, als seine Pyramide auf dem niedrig gelegenen Gelände im Nordosten von Giza zu errichten. Hätte es andererseits keinen übergeordneten Bauplan gegeben, so hätte Khufu zweifellos die Chance genutzt, die repräsentative Anhöhe für den Bau seiner Pyramide zu wählen. Khufus eigentümliche Handlungsweise verrät uns, dass »ihm die Hände gebunden waren« — er war eingeschränkt durch die Erfordernisse und die Logistik eines größeren Plans; eines Plans, den er offenbar nicht beeinflussen konnte.
Auf der Suche nach dem Hauptschlüssel
Ob nun die Pyramiden von Giza separat oder als Teil eines übergeordneten Entwurfs errichtet wurden, man darf wohl zu Recht vermuten, dass ihre Erbauer sich nach irgendeinem Plan richteten. Doch leider wurden nie irgendwelche Pläne entdeckt.
Doch selbst in Abwesenheit eines Originalplans mag es mög¬lich sein, den Bauplan zu entschleiern, der damals benutzt wur¬de, um die Abmessungen der Giza-Monumente festzulegen, indem wir die Bauwerke auf geometrische Prinzipien zurückfüh¬ren. Die Logik ist einfach: Falls die Giza-Pyramiden Teil eines Gesamtplans waren, so sollte eine für alle drei Pyramiden gültige, gemeinsame Richtlinie zu erwarten sein. Das Auffinden dieses »Schlüssels« könnte dann hoffentlich das zugrunde liegende De¬sign — den Bauplan — enthüllen und nachweisen, dass die Pyra¬miden nicht einfach zufällig nach den Launen der drei Pharaos platziert wurden.
Im Laufe der Jahre hat das Internet eine wahre Schwemme an geometrisch-mathematischen Vorschlägen hervorgebracht, die nach einer Antwort auf die Frage suchen, wie die Fundament¬abmessungen der drei Hauptpyramiden von Giza zustande ge¬kommen sind und wie die Nebenpyramiden angeordnet wur¬den. Bislang konnte allerdings keiner der Vorschläge eine umfas¬sende, in sich geschlossene Lösung anbieten. Der Hauptschlüssel des Giza-Bauplans ist nach wie vor in frustrierende Finsternis gehüllt.
Wie zu Beginn dieses Artikels erklärt wurde, hat Robert Bauval ausführlich dargelegt, dass die drei Hauptpyramiden von Giza als symbolische Figuren der drei Gürtelsterne des Orion entworfen und erbaut wurden - nicht in vollkommener Mitten¬entfernung, aber sehr nahe daran. Angenommen, Bauval hat mit seiner Hypothese Recht: Könnten uns dann die Gürtelsterne des Orion noch andere Aspekte des Pyramidendesigns verraten? Ist es denkbar, dass die Gürtelsterne als Vorlage dienten, um die tatsächlichen geometrischen Maße der Fundamente der drei Hauptpyramiden von Giza zu bestimmen? Kurzum: Könnten die Gürtelsterne des Orion der schwer fassbare Designschlüssel, das zugrunde liegende Richtprinzip für den Bau der Giza-Pyra¬miden sein, nach dem so viele so lange gesucht haben?
Mal sehen, ob diese Annahme sinnvoll ist.
Der »geostellare Fingerabdruck« des Orion
Drei beliebige nichtlineare Punkte (in diesem Fall die drei Sterne des Orion) können dazu benutzt werden, um drei quadratische Grundstrukturen zu bilden, wobei die sogenannte Technik des »geostellaren Fingerabdrucks« angewandt wird. So lässt sich auch von den Gürtelsternen des Orion ein individueller »geostellarer Fingerabdruck« erstellen.
Wie sich zeigt, stimmen die Abmessungen der drei Haupt¬pyramiden von Giza proportional mit den drei Grundflächen überein, die sich durch den geostellaren Fingerabdruck der Ori¬on-Gürtelsterne ergeben, was auf einen deutlichen Bezug beider Systeme zueinander hinweist. Darüber hinaus lässt sich auch zeigen, dass sich durch jede der drei Hauptpyramiden des geostellaren Fingerabdrucks drei Linien ziehen lassen, auf denen dann wiederum die Königinnenpyramiden von Menkaure und Khufu ihren Platz haben.
Es scheint schon eine gewisse Ironie des Schicksals darin zu liegen, dass die mathematische »Lösung« des Giza-Design-Rät-sels, nach der so viele über so viele Jahre hin suchten, von gewissen Personen erforscht wurde, um Bauvals Orion-Hypo¬these zu widerlegen. Wie sich aber nun gezeigt hat, enthalten die Gürtelsterne des Orion tatsächlich den Schlüssel zur Lösung des mathematischen Designs - den Giza-Bauplan -, nach dem jene Personen so leidenschaftlich geforscht hatten.
Doch damit nicht genug: Der Einfluss des Orion auf Giza geht noch weiter — viel weiter.
Während der geostellare Fingerabdruck des Orion in sich selbst schon einen überzeugenden Nachweis für eine direkte (mathematische) Beziehung zwischen den Giza-Pyramiden und den Gürtelsternen des Orion erbringt, wäre eine unabhängige Bestätigung dieser Verbindung wünschenswert, um die Hypo¬these weiter zu erhärten. Ließe sich nachweisen, dass andere Bauten in Giza ebenfalls eine Verbindung zu den Gürtelsternen des Orion haben (mit einer offensichtlichen Platzierung der Bauten im Gefüge des geostellaren Fingerabdrucks), so würde dadurch eine unabhängige Bestätigung der Orion-Giza-Hypo-these erbracht - wenn auch vielleicht nicht auf schlüssige Weise, so doch immerhin jenseits aller sinnvollen Zweifel.
Königinnen der Präzession
Solch eine unabhängige Bestätigung könnte in der relativen Lage der beiden Dreiergruppen der »Königinnenpyramiden« auf dem Plateau zu erwarten sein.
Vor der Darlegung dieses untermauernden Nachweises einer Verbindung des Orion mit den beiden Gruppen der Königin¬nenpyramiden sollten wir hier zunächst etwas Zeit verwenden, um das astronomische Phänomen der »Präzession« kennenzu¬lernen.
Die meisten von uns sind vertraut mit der täglichen, 24 Stun¬den dauernden Rotation der Erde. Ebenfalls wird uns die zweite Bewegung der Erde geläufig sein, nämlich ihre jährliche, 365 Tage dauernde Rotation um die Sonne. Darüber hinaus gibt es aber noch eine dritte, viel weniger wahrnehmbare Erdbewe¬gung, genannt »Präzession«.
Wenn wir den Nachthimmel beobachten, können wir erken¬nen, dass die Sterne langsam in ost-westlicher Richtung rotieren. Für einen Zeitraum von etwa 13 000 Jahren jedoch drehen sich die Sterne des Nachthimmels langsam von West nach Ost (rück¬läufig), machen Halt, um sich dann während 13 000 weiteren Jahren langsam zum Ausgangspunkt zurückzudrehen - wie das Schwingen eines Uhrpendels. Die gängige Erklärung dieser »Präzessionsdrift« besagt, dass sie als Folge einer sehr langsamen Taumelbewegung der Erde auftritt, während diese sich um ihre eigene Achse dreht.
Das Endergebnis dieser »Präzessionsdrift« ist, dass die Punkte, wo die Sterne am Horizont auf- und untergehen, sich über einen längeren Zeitraum verschieben — ungefähr ein Grad Präzes¬sionsdrift alle 72 Jahre. Ein nützlicher Aspekt dieser Präzes-sionsdrift besteht darin, dass sie als Anhaltspunkt dienen kann, um die Zeit »aufzuzeichnen« oder zu berechnen und wichtige Daten festzuhalten. Wenn wir zum Beispiel zwei Steinobelisken auf einen aufgehenden Stern justieren, der genau in südlicher Richtung liegt (180 Grad), so markieren wir damit ein ganz bestimmtes Datum. Im Laufe der vorüberziehenden Jahre und Jahrzehnte driftet der Stern langsam am Horizont dahin, wobei er die Ausrichtung auf die Obelisken weit hinter sich lässt. Die Obelisken sind jetzt nicht mehr auf den Stern am Horizont ausgerichtet, aber sie können als astronomischer »Markierungs¬punkt« dienen, der anzeigt, wann sie auf den Zielstern ausgerich¬tet waren.
Beobachten wir dann später, dass der betreffende Stern bei¬spielsweise bei 190 Grad aufgeht (bzw. untergeht), so können wir darauf schließen, dass er etwa zehn Grad von seiner ur¬sprünglichen Position abgedriftet ist, was uns zeigt, dass die Justierung vor etwa 720 Jahren vorgenommen wurde, denn 72 Jahre entsprechen ungefähr einem Grad Präzessionsdrift.
Wenn wir nun die Pyramidenbauten in Giza betrachten, so finden wir eine klare, unzweideutige Ausrichtung jener Bauten auf die Gürtelsterne des Orion vor, wie sie um etwa 10 500 v. Chr. am südwestlichen Horizont auftauchten. Diese Justie¬rung betrifft insbesondere die kleinste der drei Großen Pyrami¬den - die Pyramide von Menkaure - und ihr Gegenstück am Sternenhimmel, den Stern Mintaka im Orion-Gürtel. Mintaka ist der Zielstern, auf den die Pyramide des Menkaure (unser »Obelisk«) ausgerichtet wurde.
Etwa um 10500 v.Chr. ging der Stern Mintaka nahe des südwestlichen Horizonts unter - 212 Grad Azimut (212 Grad im Uhrzeigersinn vom genauen Norden aus gerechnet).
Übertragen auf die Giza-Pyramiden, lässt sich beobachten, dass die Ausrichtung vom Schiussstein der Khafre-Pyramide über den Schlussstein der Menkaure-Pyramide ebenfalls 212 Grad Azi¬mut beträgt.
Zu genau gleicher Zeit standen die drei Königinnenpyramiden von Menkaure in einer horizontalen Linie nahe des südwest¬lichen Horizonts und reflektierten damit die Stellung der drei Gürtelsterne, die zum gleichen Zeitpunkt in ganz ähnlicher Konstellation standen, kurz bevor sie am südwestlichen Hori¬zont untergingen.
Bezeichnenderweise fand diese Ausrichtung von Menkaure/ Mintaka und von den Menkaure-Königinnen mit den drei Gürtelsternen zu einem sehr bedeutsamen Zeitpunkt der präzes-sionalen »Pendelbewegung« der drei Gürtelsterne statt. Dieser recht einzigartige Moment - markiert durch die 212-Grad-Ausrichtung von Menkaure/Mintaka und bestätigt durch die Stellung von Menkaures Königinnenpyramiden - ist genau der Moment, in dem die Gürtelsterne zum Stoppen kamen und ihre 13 000 Jahre dauernde präzessionale Rückreise zum Gegenpol am Himmelszelt antraten. Dieser einzigartige Moment vor etwa 10 500 Jahren wird als minimaler Kulminationspunkt bezeichnet. Nach wieder 13 000 Jahren Drift in der Gegenrichtung, das heißt im Jahre 2500 n. Chr., werden die Gürtelsterne ihren maximalen Kulminationspunkt erreichen, und so nimmt ihre präzessionale Pendelbewegung ihren Lauf— für immer.
Es lassen sich noch weitere Nachweise erbringen für diese sehr erstaunliche Beziehung zwischen den Giza-Pyramiden und den Gürtelsternen des Orion. Wie bereits erwähnt, schwingen die Gürtelsterne am Himmel hin und her wie ein Uhrpendel, indem sie unmerklich langsam vom minimalen zum maximalen Kulminationspunkt wandern. Wir haben bereits beschrieben, wie die Menkaure-Königinnen als Markierungspunkte benutzt wurden, um den minimalen Kulminationspunkt der Gürtel¬sterne des Orion zu kennzeichnen, als diese Sterne in horizontaler Richtung nahe des südwestlichen Horizonts angeordnet wa¬ren. Daraus ergibt sich die folgende offensichtliche Frage: Wie und wo werden die Gürtelsterne stehen, wenn sie um etwa 2500 n. Chr. ihren maximalen Kulminationspunkt erreichen?
Mithilfe astronomischer Software lässt sich ermitteln, dass die Gürtelsterne an ihrem maximalen Kulminationspunkt am östli¬chen Horizont aufgehen werden, und zwar 90 Grad gedreht (lotrecht zum Horizont) im Vergleich zum Untergehen der For¬mation am minimalen Kulminationspunkt. Erstaunlicherweise ist das auch genau die Stellung der anderen drei Königinnen¬pyramiden neben der Großen Pyramide Khufus.
Betrachtet man die Königinnenpyramiden als präzessionale Markierungspunkte, so könnte diese Information hilfreich sein, um die merkwürdige Abwesenheit jeglicher Königinnenpyrami¬den in der Nähe der Pyramide von Khafre zu erklären, der fünf Königinnen gehabt haben soll. Da nur die maximalen und minimalen Kulminationspunkte veranschaulicht werden müssen (irgendwelche Zwischenpunkte sind kaum interessant), ist die mysteriöse Abwesenheit von Khafres Königinnen somit erklärt.
Folglich veranschaulichen die beiden Gruppen der Königin¬nenpyramiden von Giza die minimale und maximale Kulmina¬tion der Gürtelsterne des Orion (bei deren Auf- bzw. Unter¬gang). Die Zeitspanne zwischen diesen beiden Ereignissen (ein astronomischer Halbkreis) beträgt rund 13 000 Jahre. Die Tatsa¬che, dass solche astronomischen Informationen uns in Giza sozusagen auf dem Tablett serviert werden, ist ganz außerge¬wöhnlich und unterstützt die Idee des geostellaren Fingerab¬drucks des Orion, durch den, wie gesagt, die Grundrisse der drei Hauptpyramiden von Giza definiert werden. Daraus ergibt sich, dass bei drei separaten Gebäudegruppen in Giza eindeutig auf das Sternbild des Orion hingewiesen wird. Das alles bestätigt die These des geostellaren Fingerabdrucks des Orion.
Doch damit nicht genug - es gibt noch weitere Parallelen zwischen dem Orion und Giza.
Einer der Hauptkritikpunkte der Gegner von Bauvals Orion-Giza-Hypothese war die Tatsache, dass die Gürtelsterne nicht in vollkommener Übereinstimmung mit der Mittenentfernung der Giza-Pyramiden stehen. Die Abweichung ist jedoch sehr gering und es scheint sogar durchaus sinnvoll, dass der kleine Fehler bewusst eingebaut wurde. Wir können das aus der Tatsache ableiten, dass der geostellare Fingerabdruck des Orion so genau auf die Giza-Pyramiden zugeschnitten ist. Eine solch genaue Übereinstimmung kann nur dann erreicht worden sein, wenn die Beobachtungen und Aufzeichnungen der Gürtelsterne fast perfekt waren.
Außerdem: Wenn wir die Gürtelsterne über die Pyramiden¬mittelpunkte legen, so sehen wir, dass der mittlere Stern (Alnilam) in seiner Lage ein wenig vom entsprechenden Pyramiden¬mittelpunkt abweicht. Umfahren wir jedoch die Pyramiden mit einem Kreis, der durch die drei äußersten Pyramidenpunkte läuft, so sehen wir, dass der Mittelpunkt dieses Großen Giza-Kreises (Great Giza Circle oder GGC) nahezu perfekt mit dem Zentrum von Alnilam zusammenfällt.
Offenbar haben die prähistorischen Giza-Designer die Gürtel¬sterne mit hoher Genauigkeit auf das Giza-Plateau kopiert, wobei sie jedoch aus irgendeinem Grunde beschlossen, Khafres Pyramide minimal neben dem Alnilam/GGC-Zentrum zu platzieren.
Interessanterweise haben die Forscher Scott Sacharczyk und Rob Miller unabhängig davon herausgefunden, dass der Versatz des Khafre-Zentrums gegenüber dem Zentrum des GGC genau 44 Ellen geteilt durch 14, was fast genau den Wert Pi ergibt: 44:14 (oder gekürzt 22:7) = 3,14285714, beträgt. Es könnte also sein, dass der G2-Versatz absichtlich eingebaut wurde, um die Zahl Pi (und auch den Großen Giza-Kreis) im Design zu verschlüsseln.
Khafres Pyramide hat zwei Eingänge - ein einzigartiges Merkmal, das Forscher wie Miroslav Verner, Amelia Edwards
(1831-1892) und Ahmed Fahkry (1905-1973) sowie Vito Maragioglio und Celeste Rinaldi (durch ihre von 1963 bis 1975 dauernden Untersuchungen) als einen möglichen Hinweis dar¬auf gesehen haben, dass die Lage der Khafre-Pyramide verscho¬ben wurde, sodass sie nun ein Stück weiter nordöstlich als ursprünglich geplant liegt. Diese Ansicht stimmt mit dem Be¬fund des geostellaren Fingerabdrucks und dem Zentrum des Großen Giza-Kreises überein.
Wir können zusammenfassend sagen: Die Anordnung und die Abmessungen der verschiedenen Bauten von Giza liefern uns vielschichtige, klare Nachweise dafür, dass es eine Verbindung zwischen den Giza-Pyramiden und den Gürtelsternen des Orion gibt. Angesichts dieser mathematischen und astrologischen Be¬funde — und angesichts der bereits von Bauval, Gilbert und Hancock erbrachten kulturellen Belege für eine solche Verbin¬dung - muss die Ansicht von Ägyptologen, die weiterhin bezwei¬feln, dass eine solche Verbindung von den prähistorischen Archi¬tekten voll beabsichtigt war, nunmehr als unhaltbarer Stand¬punkt gelten.
Es liegen jetzt genügend Belege vor, um uns die Schlussfolge¬rung zu gestatten, dass die Giza-Bauten auf der Grundlage eines übergreifenden Plans errichtet wurden. Die hier vorgelegten Befunde zur Unterstützung dieses Standpunkts mögen die Ori-on-Giza-Verbindung zwar nicht schlüssig beweisen, aber gemes¬sen an der Last der Befunde darf man wohl ruhigen Gewissens behaupten: Die Orion-Giza-Verbindung ist jetzt genügend un¬termauert worden, um die Hypothese als erwiesen zu erachten -erwiesen jenseits begründeter Zweifel.
Die »Äonenuhr« in Giza
Akzeptieren wir die Orion-Verbindung mit den Giza-Pyrami¬den, so bleibt noch die Warum-Frage zu klären: Warum wandten
die prähistorischen Designer so viel Blut, Schweiß und Tränen auf, um diese gigantische astronomische Uhr zu erschaffen und so auf die Zeit um 10500 v. Chr. und die Zeit um 2500 n. Chr. hinzuweisen? Warum wiesen die prähistorischen Designer durch eine Reihe von Monumenten, die ohne Weiteres zu dem Zweck geplant gewesen sein könnten, bis 2500 n. Chr. und noch länger zu halten, auf jenen astronomischen Halbkreis von 13.000 Jah¬ren hin? Und hat es vielleicht etwas zu bedeuten, dass um 10 500 v. Chr. die letzte Eiszeit ein abruptes und recht dramati¬sches Ende nahm, bei dem zahlreiche Tier- und Pflanzenarten ausstarben? Welches Ereignis könnte derart schreckliche globale Folgen nach sich gezogen haben?
Was auch immer die Menschen hinter dem Design und dem späteren Bau dieser monumentalen »Äonenuhr« in Giza inspi¬riert haben mag, es muss offenbar von immenser Wichtigkeit gewesen sein. Die beiden Gruppen der Königinnenpyramiden von Giza verkörpern die Gürtelsterne des Orion, die auf zwei verschiedene Arten ausgerichtet sind und somit zwei unter¬schiedliche Daten anzeigen: Die horizontale Ausrichtung zur Zeit der minimalen Kulmination weist auf die Zeit um 10 500 v. Chr. hin, die senkrechte Ausrichtung zur Zeit der maximalen Kulmination auf die Zeit um 2500 n. Chr. !!

Hohlräume in der Cheops Pyramide
in Pyramiden - Cheopspyramide 15.09.2018 11:18von Simbelmyne • 32.666 Beiträge
So mancher Forscher wurde vom ägyptischen Behördenapparat schamlos ausgebootet. Seit 2011 sitzt Shaun Whitehead auf einem Schatz brisanter Messdaten, Videoaufhahmen und Informationen über die letzten Rätsel der Cheops-Pyramide — und muss darüber immer noch schweigen. Denn in Kairo begann man ohne ihn nochmals bei null, um ganz offensichtlich seine Lorbeeren zu ernten. Ebenso wie man in den frühen 1990er-Jahren bereits den deutschen Ingenieur Rudolf Gantenbrink Knall auf Fall in die Wüste geschickt hatte.
Rückblende ins Jahr 2011, kurz nach der ägyptischen Revolution. Es war die Nachricht des Tages: Kairos selbstherrlicher Pyramidendiktator Zahi Ha-wass nimmt endlich seinen Hut. Oder wie offiziell vermeldet: »Hawass wurde
als Chef der Altertümerverwaltung ab¬gelöst.« Auf Kohlen saß in jenen turbu¬lenten Wochen auch Shaun Whitehead. Mit einem neuen Hightech-Mini¬roboter sollte sein Expertenteam in Hawass' Auftrag der Cheops-Pyramide endlich ihr letztes großes Rätsel ent¬reißen. Auftrag: die abschließende Er¬forschung der zwei mysteriösen, bis zu 60 Meter langen, 20 Zentimeter brei¬ten und hohen »Luftschächte« in der Königinnenkammer. Der eine Gang südlich ausgerichtet, der andere nörd¬lich. An deren Enden: kuriose Ab¬schlusssteine oder »Schatztüren« mit jeweils zwei zerbrechlichen Kupfer¬stiften, auf die sich bis heute niemand einen Reim machen kann.
Aufgespürt hatte die winzigen Pfor¬ten ins Unbekannte 1993 der Münch¬ner Ingenieur Rudolf Gantenbrink — ebenfalls mit einem Miniroboter. Bereits dazumal hatten ägyptologi-sche Koryphäen wie Professor Rainer Stadelmann vom Deutschen Archäo¬logischen Institut das über 4500 Jahre alte Riesenbauwerk selbstherrlich als »endgültig erforscht« erklärt. Und dies, obwohl dort bis heute weder Mumien noch Schätze gefunden wurden — ge¬schweige denn Hieroglyphen im In¬nern, die den Herrscher Cheops als Erbauer priesen.
Der arabische Historiker Al-Maqrizi (1364-1442) dagegen weiß in seiner Schrift Chitat von einer bislang unbe¬kannten »Geheimkammer« im Monu¬ment zu erzählen, in der »vor der Flut« allerlei Schätze verstaut worden seien:
»Waffen, die nicht rosten« oder »Glas, das sich zu¬sammenfalten lässt, ohne zu zerbrechen«. Ein ge¬fundenes Fressen für Ha-wass. Ende Dezember 2002 hatte er Ganten-brinks Entdeckung kurzerhand an sich gerissen. Frustriert musste der Münch¬ner Ingenieur zu Hause vor dem TV-Bildschirm mitverfolgen, wie die Ägyp¬ter seine Forschungen mit dem National-Geographie-Konzern im Rahmen einer umstrittenen »Live-Übertragung« samt neuem Roboter weiterführten. Ergebnis: Hinter dem rätselhaften Abschlussstein mit den Kupferklammern im Südschacht befindet sich eine winzige Kammer!
Verschwiegen wurde von Hawass und Konsorten damals nicht zuletzt der Fund zweier Kristalle im Südschacht — »vermudich aus neuerer Zeit« — sowie weiterer Artefakte. Im Nordschacht wiederum stieß sein ferngesteuertes Gefährt nach rund 20 Metern ebenfalls auf kuriose Relikte — darunter ein altes Ein¬trittsticket zu den Pyramiden und zur Sphinx. Die erfolgverwöhnten Augen des ägyptischen Egomanen begannen zu leuchten! Also ließ er ab 2009 den Briten Shaun Whitehead und dessen Team mit einem weiteren Miniroboter unter sei¬ner Aufsicht weitersuchen. Name dieser dritten Mission: »Djedi-Projekt«. Mit¬finanziert wurde sie vom französischen Software-Riesen Dassault Systemes.
Alle Forschungsresultate blieben vorläufig geheim. Und dies, obwohl es Whiteheads Kollegen mit ihrem Gefährt gelungen war; drei Expeditionen durch den südlichen Luftschacht in der Cheops-Pyramide zu unternehmen: zwei zu Testzwecken,
die dritte — am 29. Mai 2010 — bis ans Schachtende. Dort konnte der Roboter dank beweglicher »Schlangenkamera« zum zweiten Mal nach 2002 hinter die dortige »Tür« mit den Kupferklammern in den Hohlraum spähen — und endlich ausleuchten und filmen, was seinen Vorgängern in der Dunkelheit mangels Bild¬auflösung verborgen geblieben war.
2011 wurden Teile der Forschungsresultate dank Whitehead & Co. in den Annales du Service des Antiquites de l'Egypte publiziert. Wie dort ausgeführt, stieß das Team im Hohlraum am Schachtende vor einem zweiten Blockierungsstein auf rote und schwarze Handwerkermarkierungen. Aufgemalt sind diese auf dem Boden der winzigen Kammer — samt einer zusätzlichen roten Markierungslinie. Niemand weiß diese Graffiti bis heute exakt zu deuten. Zudem bemerkte man an der linken Seite eine dunkle, zersplitterte Stelle im Stein, bei der einst eine »chemische Reaktion« stattgefunden haben dürfte. Rätsel über Rätsel.
Doch noch eine dritte Frage bleibt offen: Warum befindet sich am hinteren Ende des Hohlraums eine lange, bläulich-grünliche Linie? Kein Fachjourna¬list hat diesen Aspekt bis heute je genauer hinterfragt, obwohl davon geheim gehaltene Videoaufnahmen vorliegen, die der Autor exklusiv ansehen durfte. Selbst namhafte Ägyptologen haben davon keinen blassen Schimmer. Dazu Shaun Whitehead: »Besagte >Rinnsal-Linie< verläuft einigermaßen vertikal vom oberen Ende des zweiten Blockierungssteins nach unten und endet drei bis vier Zentimeter über dem Boden des Hohlraums. Die Farbe lässt vermuten, dass sie Kupferoxid enthält. Entweder entstand sie bereits, als der Steinblock im Steinbruch bearbeitet wurde. Oder aber ein verborgenes Kupferrelikt in unmittelbarer Nähe ist dafür verantwortlich, was indes die erhebliche Präsenz von Wasser voraussetzen würde.«
Ein verborgenes Kupferrelikt?! Verbirgt sich hinter oder über der winzigen Kammer somit vielleicht ein weiterer Hohlraum? Und falls ja: Was wurde dort in grauer Vorzeit verborgen? Schrift¬rollen? Cheops' Mumie? Wertvolle Schätze? Vielleicht sogar ein Relikt aus einer anderen Welt? Oder eben¬falls nur heiße Wüstenluft? 2011 sollte unter Whiteheads Regie eine weitere »Djedi«-Expedition stattfinden, um ein für alle Mal Licht ins Dunkel zu brin¬gen. Dabei wollte man am Ende des Hohlraums endlich auch bohren — um mittels Kamera einen ersten Blick in
die dahinter vermutete zweite Geheimkammer zu erhaschen. Danach kehrte in Kairos Behördenstellen leider jahrelange Funkstille ein. Nichts ging mehr. Wegen der ägyptischen Revolution. Geduld war ge¬fragt. Viel Geduld. Und noch mehr Geduld.
Umso überraschender die jüngste Ankündigung, dass ein komplett neues Forscherteam Ägyptens Al¬tertümer seit 2016 erneut durchleuchten lässt - also quasi wieder ganz von vorne beginnt. Ebenso ver¬blüffend, dass dabei auch Großmaul Zahi Hawass wieder mitmischt, dem die neuen Machthaber trotz mehrfacher Absetzung unlängst einmal mehr den ro¬ten Teppich ausrollten. »Warum man in Kairo dieses neue Projekt unterstützt, ist mir - höflich formuliert — ein Rätsel«, knurrt »Djedi«-Projektleiter Shaun Whitehead auf Anfrage. »Immerhin war¬ten wir bis heute auf Bescheid, wann wir unsere Roboterer¬kundung von damals endlich zu Ende führen dürfen.« Seit 2011 hatte Whitehead immer wieder bei den zuständigen Behörden in Kairo angeklopft, per Mail oder Telefon — und wurde eben¬so regelmäßig vertröstet, Antwort: »Haben Sie Geduld. Wir melden uns wieder bei Ihnen!«
Dass das nun laufende neue Projekt eine ähnliche 3-D-Scan-Erforschung der dortigen Monumente verfolgt, wie von ihm und seinem Team ursprüng¬lich angedacht, mutet nicht nur für den Briten wie Hohn an. Kommt dazu, dass der Mann viel privates Geld in seine Untersuchungen investiert hat — und mit Mehdi Tayoubi (Daussault Systemes) einer seiner Teampartner zudem kurzerhand die Seiten gewech¬selt hat. Tatsächlich zählt Tayoubi zu den Strippenzie-hern des neuesten Durchleuchtungsprojekts - in en¬ger Kooperation mit Hany Helal von der Universität Kairo. Und Letzterer zeigt keinerlei Interesse am Vi¬deo- und Datenmaterial des »Djedi«-Teams. Bereits im November 2015 ließ Helal auf Nachfrage verlau¬ten, dass man »selber genügend Experte« sei und kei¬ne Schützenhilfe des Vorgängerteams benötige.
Im November 2017 folgte der bislang letzte Pau¬kenschlag im intriganten Pharaonen-Stadl: In der Fachzeitschrift Nature vermeldete Tayoubis mittler¬weile als »ScanPyramids Project« auftretende Truppe die Entdeckung eines weiteren bislang unbekann¬ten, 30 Meter langen Hohlraums oberhalb der Gro¬ßen Galerie im Cheops-Bau. Noch weiß niemand Genaueres. »Interessant scheint mir vor allem dessen Position«, kommentiert die Schweizer Ägyptologin Susanne Bickel zurückhaltend. Vermutlich wollte man damit die Galerie von der darüberliegenden Steinmasse entlasten, spekuliert sie.
Um eine weitere Grabkammer »wird es sich wohl nicht handeln«, glaubt auch Felix Arnold vom Deut¬schen Archäologischen Institut in Madrid. »Obwohl bei den alten Ägyptern alles denkbar ist« — so etwa die Einlagerung eines großen hölzernen Sonnen-schiffes, das den Pharao im Jenseits zu neuen Ufern bringen sollte. Dennoch spreche vieles dafür, »dass es sich um einen bislang unbekannten Hohlraum handelt, vergleichbar den bekannten Entlastungs¬kammern über der Königskammer«.
Und die winzigen Abschlusssteine an den Schacht¬enden der Königinnenkammer? Diese harren nach wie vor ihrer Erforschung, weil Zahi Hawass derzeit einmal mehr nach neuen Partnern sucht, die ihm auf eigene Kosten ewigen Ruhm bescheren sollen. Shaun Whitehead jedenfalls hat die Hoffnung nicht aufge¬geben, seine »Djedi«-Mission womöglich doch noch vollenden zu können. Auch Pyramidenforscher Ru¬dolf Gantenbrink aus München will nach jahrelanger Abstinenz bald wieder nach Kairo zurückzukehren. Wetten, dass Hawass die guten Geister, die er einst rief und später verfluchte, so schnell nicht mehr los wird?

Schwerkraft und Transport
in Pyramiden - Cheopspyramide 15.09.2018 13:55von Simbelmyne • 32.666 Beiträge

SCHWERKRAFT UND TRANSPORT
Ein massiver Muldenkipper läßt einen durchschnittlichen Kleinlaster wie einen Spielzeug-Lkw aussehen. Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 350 Tonnen ist er nur für den Einsatz im Bergbau zugelassen, da dieses zulässige Gesamtgewicht auf Bundesstraßen auf 40 Tonnen beschränkt ist und der Lastwagen schon ohne Ladung mehr wiegt. Ich sah zu, wie er in der Tagebau-Kupfermine in Bisbee im amerikani¬schen Bundesstaat Arizona auf Herz und Nieren getestet wurde. Plötzlich erschütterte mich eine Erkenntnis bis ins Mark, die einiges an den richtigen Platz rückte, über das ich mir lange intensive Gedan¬ken gemacht hatte.
Der Muldenkipper ist der leistungsstärkste Lastwagen, den es in der modernen Zivilisation gibt, und er könnte die schwersten vorzeit¬lichen Lasten befördern, die die Landschaften in Ägypten, Bolivien und Peru übersäen. An einem Punkt meines Lebens, an dem ich gerade dabei war, mich in die literarische Welt der frühen Hochkultu¬ren einzuarbeiten, jobbte ich in einem Zementbautrupp in einem wichtigen Standort der Holzindustrie. Dort lernte ich mit schweren Lasten umzugehen, sah, was ein Frontlader zu heben und ein doppel-achsiger Tieflader-Holztransporter zu schleppen vermögen.
Während jahrelanger Forschungen zu den Geheimnissen antiker Zivilisationen hat die Reaktion der Menschen auf die zyklopischen Steinblöcke, die über eine weite Distanz transportiert und in große Höhe gezogen werden mussten, stutzig werden lassen. Sie reagierten entweder mit einem verständnislosen Blick oder einem Achselzucken, das aussagen sollte: »Okay, und was ist daran so beson¬ders?« Diese Reaktion frustrierte mich und erzeugte in mir den Ein¬druck, dass es mir nicht gelungen sei, das Ausmaß und die Schwierig¬keiten des Problems angemessen zu vermitteln. Doch später wurde mir klar, dass der Grund, aus dem die meisten Menschen die Größenord¬nung des Problems — und die wirklichen »Rätsel« auf der Erde - nicht verstehen, im Kern mit mangelnder einfacher und unmittelbarer Er¬fahrung zu tun hat.
Vor 150 Jahren lebten die meisten Menschen auf Bauernhöfen in ländlichen Regionen und waren im Allgemeinen damit beschäftigt, große Ladungen Heu, Holz oder was auch immer zu transportieren. Sie wussten, was es hieß, eine Tonne Heu zu einem Ballen zu packen und eine 140 Kilogramm schweren Holzklotz oder Felsbrocken zu heben. Aber heute heben und bewegen Maschinen diese Schwerlasten, und wir haben den unmittelbaren Zugang zu diesen Dingen verloren. Ich versuchte vor Kurzem in einem Gespräch zu diesen Problemen mit einem Freund zu erklären, warum die Ägypter die Große Pyramide nicht mit primitiven Werkzeugen und Technologien erbaut haben konnten.
Er blieb skeptisch, bis er sich an ein Ereignis erinnerte, das seine Einstellung rasch änderte. Ich erklärte ihm, ich sei bereit zuzugeste¬hen, dass die Erbauer mit den Millionen 2,5 Tonnen schweren Stein¬blöcken zurechtgekommen seien, wenn er erklären könnte, wie man die 70 Tonnen schweren Megalithen über der Königskammer bewegt habe. Ihm ging ein Licht auf. Er wurde auf einmal sehr lebhaft, als er mir erzählte, wie eine Gruppe Freunde und er versucht hatten, einen schweren Billardtisch umzusetzen. Sie hatten sich um ihn gestellt, Schulter an Schulter, und gemeinsam versucht, ihn unter »Hauruck«-Rufen zu bewegen.
Die Überraschung war groß, als sich der Billardtisch überhaupt nicht rührte. Die Männer waren nicht in der Lage, ihn auch nur einen Zentimeter von der Stelle zu bekommen. Nun hatte mein Freund das von mir geäußerte Argument verstanden. Man kann einen 70 Tonnen schweren Granitblock nicht allein mit Muskelkraft im Steinbruch anheben und auf einen Schlitten laden. Der Schwierigkeitsgrad der Aufgabe steigt exponentiell an, wenn wir uns vor Augen führen, dass 100 Tonnen schwere Steinblöcke vom Boden des Sphinx-Tempels auf
eine Höhe von mehr als sechs Metern angehoben und dort genau positioniert werden mussten. Diese ingenieurtechnischen und physi¬kalischen Probleme kann man nicht einfach durch Menschenmassen lösen, wie es die Ägyptologen versuchen. Granit weist eine hohe Dichte auf, und ein sechs Meter langer Steinblock kann bis zu 70 Ton¬nen wiegen. Wie viele Menschen können räumlich so um den Block versammelt werden, dass sie versuchen könnten, ihn zu heben? Viel¬leicht 50 Personen, aber das reicht von der Muskelkraft her nicht einmal aus, um zehn Tonnen zu heben.
Es geht hier um ein hartnäckiges und schwer lösbares Problem. Solange die Ägyptologen strikt daran festhalten, dass die zyklopischen Steinblöcke von Menschenhand nur mit Muskelkraft und Seilen bewegt und gehoben wurden, harrt es noch seiner Lösung. Alle weiteren Ansätze zur Erklärung der Bauweise durch die Ägyptologen sind rein
akademischer Natur, solange dieses grundlegende Hindernis nicht ausgeräumt wurde. Wenn sie nicht beweisen können oder wollen, das es sich so abgespielt hat, wie sie behaupten, dann ist es an der Zeit, auch ihre anderen nicht fundierten Theorien infrage zu stellen. Wir müssen dieses ganze orthodoxe Kartenhaus einfach ausrangieren und uns aus der sogenannten Debatte verabschieden.
Kehren wir zu unseren zyklopischen 350-Tonnen-Muldenkippern vom Anfang zurück. Selbst unsere stärksten Schwerlastkräne geraten mit dieser Last an ihre Grenzen. Wenn jemand die Ansicht vertritt, Menschen, Seile und Schlitten hätten Lasten gehoben und befördert, die selbst unsere stärksten Kräne und Baufahrzeuge kaum bewegen können, hielte ich diese Auffassung für ein Zeichen technischen Analphabetentums. Vor Kurzem sah ich eine Dokumentation über eine Brücke, die zusammenbrach, als ein Zug über sie fuhr. Auch hier durchlebte ich einen ähnlichen geistigen Prozess plötzlicher Erkennt¬nis wie in der Kupfermine: Diesel- oder Dampflokomotiven wiegen über 200 Tonnen. Sie sind robuste, schwere Arbeit leistende Maschi¬nen. Um sie aufzuwiegen, würde man einige große Steinblöcke aus Ägypten und/oder Peru benötigen. - Ein riesiger Kran wurde herbeigeschafft, um die Lokomotive aus dem Fluss zu fischen. Man stelle sich einmal eine Lokomotive auf der bloßen Erde oder auf Sand vor. Was würde geschehen? Sie würde sofort einsinken. Es hat schon seine Gründe, dass Eisenbahntrassen auf einem Kiesbett errichtet werden, auf dem in Querrichtung die Eisenbahnschwellen unter den Stahl¬schienen verlegt wurden.
Könnten einige tausend Menschen eine Lokomotive durch den Sand ziehen? Das ist äußerst zweifelhaft. Um das Gewicht zu tragen und den enormen Widerstand zu überwinden, müsste eine stark verdichtete Straße gebaut werden. Wie wir oben gesehen haben, sind selbst unsere modernen (US-) Bundesstraßen nur auf ein zulässiges Gesamtgewicht von 40 Tonnen ausgelegt.
Eine durchschnittliche 18-rädrige Sattelzugmaschine mit Auflieger könnte etwa 20 Tonnen transportieren; offensichtlich sind Lasten mit einem Gewicht über 20 Tonnen sehr schwer. Solche Lasten wurden aber durch ganz Ägypten transportiert. Wo finden sich Hinweise auf die dazu notwendigen Straßen? Sie können ja wohl nicht einfach verschwunden sein, da sie aus Steinen und Ziegeln errichtet werden mussten.
Nehmen wir einmal an, es seien einige antike Straßen entdeckt worden, auf denen die Steinböcke transportiert worden wären. Dies böte die perfekte Möglichkeit, die orthodoxe Schlitten-Transport-Theorie zu überprüfen. Das Problem, aufweiche Weise die Alten diese Schwerstladungen transportierten, reicht schon aus, um nach meiner Einschätzung die orthodoxen Bautheorien und die entsprechenden Zeitverläufe endgültig zum Einsturz zu bringen. Akademiker sind in der Regel nicht dafür bekannt, handwerklich veranlagt zu sein, und sie übernehmen auch nicht die schweißtreibenden Arbeiten während der Ausgrabungen vor Ort. Es ist sehr viel einfacher, einen Stift in die Hand zu nehmen und auf dem Papier einen 100 Tonnen schweren Steinblock vom Steinbruch bis zur Tempelmauer zu bewegen und dort zu verbauen. Diese Aufgabe kann in der realen Welt allein mit Muskel¬kraft ohne Unterstützung durch moderne Technologie und Ausrüs¬tung nicht bewältigt werden.
Dies musste auch der Ägyptologe Mark Lehner in diesem Jahr begreifen, als er eine Expertengruppe bildete, um zu versuchen, einen 35 Tonnen schweren Obelisken mithilfe antiker Werkzeuge und Techniken aus dem Stein zu hauen und aufzurichten. Das Experiment wurde von NOVA gefilmt. Ein Steinmetzmeister wurde ins Team geholt, um den Granitblock aus dem Steinbruch zu hauen. Unglück¬licherweise gab er auf, nachdem er alle Möglichkeiten und Tricks versucht hatte, die er kannte. Nun forderte man einen Bulldozer an, der das Felsstück aus dem Gestein löste und auf einen wartenden Lastwa¬gen verlud. Das war das Ende des Experiments, und es bewies, dass es nicht möglich ist, einen Steinblock aus dem Steinbruch zu brechen und anzuheben, der nur ein Zehntel des Gewichts des schwersten Obelisken aufwies, der heute noch in Ägypten steht.
weitere Beweise gefällig ?
Lehner versuchte niemals wieder, antike Werkzeuge einzusetzen, um zu beweisen, wie die Pyramiden gebaut wurden. In einem späteren Experiment, mit dem gezeigt werden sollte, dass ein knapp sieben Meter hohes Modell der Großen Pyramide gebaut werden könnte, setzte er zwar am Ort des Geschehens barfüßige Arbeitskräfte, aber zugleich moderne Meißel und Hämmer sowie einen Lastwagen mit einer Stahlwinde ein, der die Steinblöcke aus dem Steinbruch herbeischaffte.
Diese Vorgehensweise diskreditierte das gesamte Experiment, das aber schon für sich genommen albern war, da die Blöcke lediglich halb so groß wie die beim Bau der wirklichen Pyramide im Durchschnitt benutzten Steine waren. Wie soll so etwas beweisen, dass 70 Tonnen schwere Steinblöcke auf diese Weise fast 45 Meter senkrecht bis zur Königskammer in die Höhe gehoben wurden? Sein sieben Meter hohes Modell erinnerte an den am Anfang des Artikels erwähnten Vergleich zwischen dem Klein-Lkw und dem realen Muldenkipper. Das ganze Fiasko bewies nur, dass sich Lehner von der Größenord¬nung des Bauproblems hatte einschüchtern lassen.
Wir stoßen auf sehr ähnliche, fast unlösbare Probleme, wenn wir die Genauigkeit der Ingenieursarbeiten untersuchen, die sich beim Bau der Großen Pyramiden aufzeigen lassen. Ein anderes Beispiel dafür, wie präzise und anspruchsvoll dieses antike Großprojekt war, zeigte eine Vorführung, die Ende der 1970er-Jahre stattfand. Zu dieser Zeit galt Japan als das weltweite Wirtschaftswunderland, weil es in ökonomischer und wissenschaftlich-technischer Hinsicht ganze vorne lag. Eine japanische Gruppe, die von Nissan finanziert wurde, sollte den Beweis antreten, dass sie in der Lage sei, mit traditionellen Werkzeugen und Methoden ein 18 Meter hohes Modell der Großen Pyramide zu bauen.
Die ägyptische Regierung genehmigte das Vorhaben. Die erste Ernüchterung ereilte die Japaner bereits im Steinbruch, als sie feststel¬len mussten, dass sie die Steine nicht aus dem Felsen hauen konnten. Sie forderten Presslufthämmer an. Das nächste Problem tauchte auf, als sie versuchten, die Blöcke mit einem einfachen Lastkahn über den Fluss zu bringen. Sie konnten die Lage nicht kontrollieren und order¬ten schließlich ein modernes Schiff.
Am anderen Ufer angekommen, wurden die Probleme noch grö¬ßer, als die Japaner erkannten, dass die Schlitten im Sand versanken und sie sie nicht bewegen konnten. Sie forderten einen Bulldozer und einen Lastwagen an. Der Gnadenstoß ereilte sie, als sie versuchten, die Pyramide zu errichten, und dabei feststellten, dass sie die Steine nicht mit der erforderlichen Präzision an ihren jeweiligen Platz bugsieren konnten. Schließlich mussten sie einen Hubschrauber um Hilfe bit¬ten ...
Der Nationalstolz und die Wahrung des Gesichts sind für die Japaner sehr wichtig, und dies war ein beschämendes Erlebnis. Sie fühlten sich schrecklich gedemütigt, als sie schließlich eingestehen mussten, dass sie nicht einmal in der Lage waren, vier Mauern zu einem Scheitelpunkt zusammenzuführen. Ihr Mini-Pyramiden-Expe¬riment war grandios gescheitert. Sie verließen Gizeh traurig, aber weiser. Man kann angesichts des eben beschriebenen Fiaskos erahnen, welche unfasslich genaue Planung beim Bau der Großen Pyramide notwendig war, um die 146 Meter hohen Mauern in einem Punkt zusammenzuführen!
Wie lange brauchten die antiken Ägypter für den Bau? Die Frage ist falsch gestellt! Die richtige Frage müsste lauten: Können die Alten Ägypter die Große Pyramide gebaut haben? Und die Antwort lautet: nicht mit den Werkzeugen und Techniken, von denen die Ägyptolo-gen behaupten, dass sie benutzt worden seien.
Diese eben von mir formulierten Fragen wurden schon vor Jahrzehnten aufgeworfen und seither heftig diskutiert. Es ist Zeit, sie zur Entscheidung zu bringen und dann weiterzugehen. Alternative Histo¬riker haben auf die Rätsel hingewiesen, und die Vertreter der Orthodo¬xie sind geringschätzig darüber hinweggegangen. Dieser Stillstand ist unproduktiv, um es offen zu sagen. Orthodoxe Historiker haben es in diesen Fragen oft an der erforderlichen Sorgfalt fehlen lassen und sich nicht an die Regeln und Richtlinien wissenschaftlicher Vorgehenswei-se gehalten.
Chris Dünn hat dieses Problem angesprochen und daraufhinge¬wiesen, dass Ägyptologen eine Doppelmoral an den Tag legen, wenn es darum geht, ihre eigenen dünnen Beweise gegenüber den harten Tatsachen zu bewerten, die oben dargelegt wurden. Für sich selbst legen sie die Latte knapp 30 Zentimeter über den Boden, während sie für alternative Historiker auf 2,50 Meter gelegt wird.
Seit Mitte der 1990er-Jahre werden regelmäßig live oder aus der Konserve Videosendungen mit Zahi Hawass und Mark Lehner ausge¬strahlt, um den vorherrschenden Konsens zu unterstützen. Im Sep¬tember 2002 strahlte der amerikanische Fernsehsender Fox TV live eine Sondersendung vom Gizeh-Plateau aus, die ich mir auch angese¬hen habe. Es wurde gezeigt, wie ein Roboterfahrzeug den Schacht in der Großen Pyramide erforschte. Während sich die meisten Beobach¬ter in ihrer Analyse auf die Frage konzentrierten, ob sich das ganze Unternehmen überhaupt gelohnt habe, waren die wichtigsten Teile des Programms unbemerkt geblieben. Es handelte sich um sogenann¬ten »Füller«, die neue Informationen zur Unterstützung der her¬kömmlichen Darstellung der Geschichte enthielten. Sie waren ge¬schickt in die Sendung integriert worden und bildeten den eigentli¬chen Teil, der den Zuschauern indirekt die »wahre Botschaft« vermit¬teln sollte.
In Wirklichkeit findet gar keine »Debatte« zwischen orthodoxen und alternativen Historikern statt, weil Erstere sich weigern, eine faire und offene Diskussion zu führen oder solide Beweise für ihre Theorien vorzulegen. Jede ihrer den Bau von megalithischen Anlagen betreffen¬den Hypothesen kann einer wissenschaftlichen Überprüfung unterzo¬gen werden - mit den genannten Ergebnissen. Alternative Historiker waren dem falschen Eindruck erlegen, die andere Seite ließe sich durch faktisch begründete Argumente und unanfechtbare Beweise überzeu-
gen. Doch das war eine trügerische Annahme. Die Geheimnisse der Geschichte sind daher seit Langem zu einem politischen Wettkampf verkommen.
Meiner Ansicht nach sollten wir dieses Paradigma hinter uns lassen und aufhören, das Spiel nach den manipulierten Regeln der anderen zu spielen. Die Debatte ist vorbei, wenn es sie denn überhaupt je gegeben hat. Warum sollten wir also weiterhin unsere Zeit damit verschwenden, verstockten Geistern auf die Sprünge zu helfen? Das wäre verlorene Liebesmüh. Stattdessen verlangen einige wirklich wich¬tige Probleme unsere ganze Aufmerksamkeit: Welche intelligente Kul¬tur baute die Pyramiden-Komplexe mit diesen zyklopischen Steinen? Wie tat sie es und wo finden wir die Beweise für die eingesetzte Technologie? Sind wir die Nutznießer einer außerirdischen, jetzt aber menschlichen DNS, die dieses Rätsel lösen muss, bevor sie sich weiterentwickeln kann? Oder sind wir die Erben einer Hinterlassen¬schaft rein irdischen Ursprungs, das uns von einer »untergegangenen« Zivilisation überlassen wurde?

|
|
 Forum Statistiken Forum Statistiken
|
 | Forum Software ©Xobor.de | Forum erstellen |
 Antworten
Antworten Besucher
Besucher